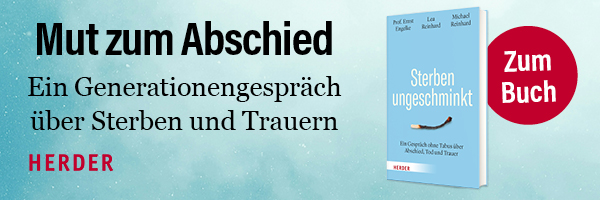Die Nationalsozialisten richteten von 1933 bis 1945 sogenannte Konzentrationslager (KZ) ein. Dort waren Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Sozialdemokraten und Kommunisten inhaftiert, sowie Christen im Widerstand und Andersdenkende, die sich zu Tode arbeiten mussten. Die Haftbedingungen waren grausam kalkuliert. Die Zwangsarbeit kombiniert mit Nahrungsmangel, fehlender medizinischer Versorgung und fehlender Kleidung sollte dazu führen, dass die inhaftierten Menschen ihre letzte Würde verlieren und an Hunger sterben.
Den Auftakt der Gedenkveranstaltungen machte am Wochenende die KZ-Erinnerungsstätte im bayerischen Dachau mit einem Gottesdienst, an dem rund 1.400 Menschen aus Deutschland und Polen teilnahmen. "Die Kirche stand, steht und wird immer eindeutig und unwiderruflich auf der Seite der Opfer stehen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Polnischen Bischofskonferenz, Erzbischof Józef Kupny (Breslau), laut Mitteilung. Im KZ Dachau waren Polen mit mehr als 40.000 Inhaftierten die größte nationale Gruppe von Häftlingen.
Dachau war eines der ersten Konzentrationslager und bestand über die gesamte Zeit der NS-Herrschaft. Mehr als 200.000 Gefangene aus über 40 Nationen waren im KZ und seinen Außenlagern inhaftiert, mindestens 41.500 Menschen starben dort. Am 29. April 1945 wurde es von der US-Armee befreit. Heute besuchen jährlich rund eine Million Menschen
In dem Lager Flossenbürg in Bayern mit seinen 80 Außenstellen waren zwischen 1938 und 1945 mehr als 100.000 Menschen inhaftiert, von denen fast jeder und jede Dritte nicht überlebte. US-Streitkräfte befreiten es am 23. April 1945.
Emilia Rotstein, die Tochter des ehemaligen Häftlings und Überlebenden Leon Weintraub (Stockholm), kritisierte laut Redemanuskript, die Menschheit lerne selten aus der Geschichte. Der Holocaust sei ausführlich dokumentiert: "Trotzdem gibt es jetzt wieder Verneiner, Menschen, die behaupten, es wäre nie geschehen". Doch "das Vergessen würde den Opfern abermals das Leben rauben", gab sie zu bedenken. Auch der 99-jährige Leon Weintraub nahm an der Gedenkveranstaltung teil.
Die geschäftsführende Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) mahnte ebenfalls laut Manuskript, 80 Jahre nach Kriegsende sei es "mehr denn je notwendig, die Erinnerung wachzuhalten". Weltweit, auch in Deutschland verhinderten und zerstörten "Hassparolen auf Straßen und in Parlamenten das vernünftige Gespräch, völkische Ideologen führen das große Wort und bringen Mahner zum Schweigen".
Im KZ Flossenbürg beutete die SS die Arbeitskraft von Häftlingen im örtlichen Steinbruch gezielt aus. Es herrschten schwerste Zwangsarbeit, Hunger, Krankheit und Gewalt. "Vernichtung durch Arbeit war das Prinzip", sagte Karl Freller, der Direktor der Stiftung bayerische Gedenkstätten. Für die Gedenkstätte sei es ein "wichtiger Meilenstein", dass der kommerzielle Abbau im ehemaligen Steinbruch nun endlich eingestellt sei.
Die Schriftstellerin Lena Gorelik sagte auf der Veranstaltung: "Gedenken hat keine räumliche oder zeitliche Begrenzung, Erinnern ist kein Akt, es ist ein Prozess. Wir haben nicht heute erinnert, um bis zum 9. November vergessen zu dürfen. Alles ist möglich, das ist vielleicht die schmerzhafteste Einsicht von allen: Dass wir Menschen sind, die zu diesem 'alles' fähig sind."