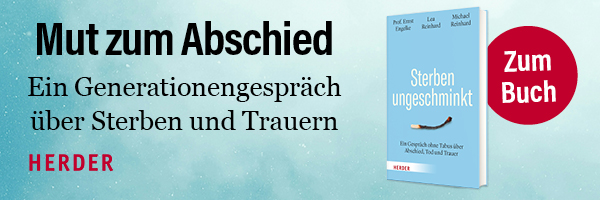Frankfurt a.M. (epd). Der Theologe und Ethiker Peter Dabrock hat die politische Dimension des internationalen Spitzensports betont. Der durch Weltverbände organisierte Spitzensport könne niemals nur Sport und unpolitisch sein, sagte er beim siebten Sportethischen Fachtag der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Frankfurt am Main.
Deutlich machte Dabrock dies unter anderem am Beispiel der beiden Fechterinnen Olga Charlan und Anna Smirnowa. Die Ukrainerin Charlan hatte nach einem Sieg 2023 der Russin Smirnowa den Handschlag verweigert, der damals noch zum Regelwerk des Fechtsports gehörte. Charlan war daraufhin von weiteren Wettkämpfen ausgeschlossen worden. Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sorgte dies für große öffentliche Empörung.
Kurz darauf änderte der Welt-Fechtverband die Regel, dass der Handschlag verpflichtend sei und hob die Disqualifizierung von Charlan auf. Die Szene mache die vielfältigen Verflechtungen zwischen Sport, Politik, Wirtschaft und Medien deutlich, sagte Dabrock, der in Erlangen Professor für Systematische Theologie ist und von 2016 bis 2020 Vorsitzender des Deutschen Ethikrats war.
Dabrock erteilte Hoffnungen auf eine Brückenfunktion des Sports zwischen verfeindeten Staaten eine Absage. Sportprojekte könnten zwar durchaus Teamgeist, Regelbefolgung, Kanalisierung von Gewalt durch fairen Wettbewerb sowie Respekt wecken und damit friedensförderlich sein, sagte er.
Bevor man sich aber zu große Hoffnungen mache, was der Sport zwischen Staaten und Kontrahenten bewirken kann, solle man „moralische Luft rauslassen“ und bescheiden schauen, „welche Hoffnungspflänzchen doch noch nicht gänzlich verdorrt sind“. Gleichwohl dürfe man „kulturpessimistischen Abgesängen“ nicht zustimmen, denn Sport sei noch immer eine der wenigen Möglichkeiten zur „Weltverbesserung durch Menschenverbesserung“, sagte er.
Die Juristin Patricia Wiater von der Universität Erlangen verwies auf die Olympische Charta, die das Friedensgebot enthalte und sich zum Schutz der Menschenrechte bekenne. „Eine Gleichgültigkeit des Sports gegenüber Konflikten unter dem Deckmantel der Neutralität schließt dies aus“, sagte die Professorin für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Menschenrechte.
Das Internationales Olympische Komitee und internationale Verbände müssten allerdings klare Richtlinien entwickeln, welche Arten von Konflikten zum Ausschluss oder zur Suspendierung von Teams und Athletinnen führen sollen. Ansonsten stehe angesichts von weltweit 120 bewaffneten Konflikten der Vorwurf von Doppelstandards und Doppelmoral im Raum.
Seinen Glauben an die verbindende Kraft des Sports betonte Alon Meyer, Präsident des jüdischen Sportverbands Makkabi Deutschland. Allerdings werde Sport missbraucht für Ausgrenzung und Hass, was sowohl auf Sportplätzen als auch in den sozialen Medien zu beobachten sei. Immer öfter werden nach seinen Worten antisemitische Plakate in Fußballstadien gezeigt und zu oft fehle es an der Solidarität der Gesellschaft, sagte Meyer und kritisierte ein „zu lautes Schweigen“. Der Fachtag fand in der Evangelischen Akademie in Frankfurt am Main mit dem Titel „Sport in Zeiten von Krieg und Frieden“ statt.