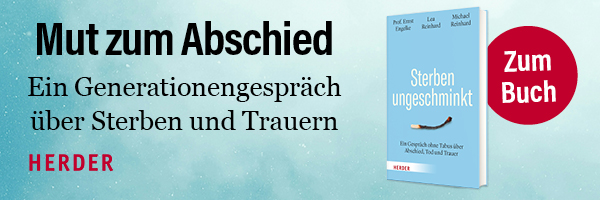epd: In der rheinischen Kirche stehen Veränderungen an, der landeskirchliche Haushalt soll um 33 Millionen Euro gekürzt werden und auch in der kirchlichen Arbeit wird nicht alles beim Alten bleiben. Wie radikal muss der Wandel sein?
Latzel: Der Wandel in der Kirche ist intensiv. Entscheidend ist, dass wir ihn mutig, kreativ und mit Gottvertrauen gestalten - um die Gaben, die uns von Gott geschenkt sind, angesichts der aktuellen Herausforderungen bestmöglich einzusetzen. Der Wandel soll dazu helfen, nahe bei den Menschen zu sein. Wir werden künftig eine größere Vielfalt an Gemeinden haben, anstelle einer Monokultur von klassischen Ortsgemeinden. Das ist die sogenannte Mixed Ecology. Ziel ist es, dass wir Menschen geistlich, seelsorglich, diakonisch stärken und sie Kirche als relevant für ihr Leben erfahren.
Für die verschiedenen Räume werden wir unterschiedliche Angebote haben. Da kann es die Jugendkirche, Diakoniekirche oder Kulturkirche in guter Vernetzung miteinander geben. Künftig werden noch mehr Ehrenamtliche Verantwortung übernehmen, deswegen wollen wir die theologische Kompetenz und Sprachfähigkeit des Glaubens bei allen Mitarbeitenden weiter stärken. Auch digitale Kommunikation wollen wir weiter stärken. Leitend ist für uns der Dreiklang: unmittelbar an der Sache Jesu Christ - relevant für die Menschen - flexibel in den Formen.
Wie soll das bei einer so komplexen Struktur wie der rheinischen Kirche mit hunderten Gebietskörperschaften funktionieren?
Latzel: Unsere Stärke ist, dass wir dezentral aufgestellt sind, unmittelbar vor Ort, nahe bei den Menschen. Die Menschen in Oberhausen, Essen, Wuppertal, dem Saarland oder dem Hunsrück wissen am besten, was vor Ort geht oder nicht. Wir müssen individuell fragen, was jemand vor Ort braucht. Veränderungen schafft man, indem man sie selber lebt, und über gute Beispiele. Diese verbreiten sich dann, so wie es auch in den biblischen Gleichnissen verheißen ist.
"Das Entscheidende passiert in der Begegnung der Menschen vor Ort."
Mit dem Erprobungsgesetz schaffen wir flexible Rahmenbedingungen zum Ausprobieren. Der Evangelische Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch erprobt beispielsweise eine Superintendenten-Doppelspitze. Als Landeskirche haben wir dafür eine dienstleistende Funktion. Wir stärken eine Ermöglichungskultur, das Entscheidende passiert in der Begegnung der Menschen vor Ort.
Die Landeskirche soll "flexibel in den Formen" werden. Was heißt das genau?
Latzel: Bei der Landessynode 2024 haben wir etwa die sogenannte Lebensordnung verändert. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir kirchliches Handeln stärker an die Lebenswirklichkeit von Menschen anpassen. Wenn jemand sein Kind woanders als in der Wohnortgemeinde taufen lassen möchte, machen wir das möglich. Wenn nicht die Eltern die Verantwortung der Erziehung im christlichen Glauben nach der Taufe wahrnehmen, schauen wir, wer es stattdessen machen könnte. Ein anderes Beispiel sind große Tauffeste oder Pop-Up-Hochzeiten, bei denen Paare sich ohne Anmeldung segnen lassen können. Gottes Geist kennt viele Wege zum Menschen, und wir wollen ihm dabei folgen und dienlich sein.
Die rheinische Kirche will die Verbeamtung von Pfarrern und Kirchenbeamten beenden. Warum?
Latzel: Der Beamtenstatus bei Pfarrerinnen und Pfarrern hat über viele Jahre dafür gesorgt, dass sie vor dem Druck von anderen geschützt werden und wir stabile kirchliche Verhältnisse haben. Mittlerweile sieht die Situation aber anders aus. Für verbeamtete Pfarrerinnen und Pfarrer gehen wir zum Teil Verpflichtungen für über 50 Jahre ein, das ist gegenüber künftigen Generationen kaum zu verantworten. Der kirchliche Haushalt soll nicht immer stärker durch Versorgungslasten für Pensionen und Beihilfe gebunden sein.
"Der Pfarrberuf ist für mich einer der schönsten Berufe überhaupt."
Wir haben dazu aber auch schon andere Änderungen begonnen. Dazu zählen die Begrenzung der Arbeitszeit, was in einem Beamtenverhältnis eher unüblich ist, oder die Auflockerung der Residenzpflicht. In diesem Jahr prüfen wir sorgfältig, welche Auswirkungen die Abschaffung des Beamtenstatus finanziell und im Blick auf das Dienstverhältnis hätte. Auch andere Landeskirchen sind an dem Thema dran. Der Pfarrberuf ist für mich einer der schönsten Berufe überhaupt und er hat eine Schlüsselfunktion für unsere Kirche. Uns ist wichtig, dass er auch unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen attraktiv und einladend ist.
Apropos andere Landeskirchen: Schauen Sie, was Sie von anderen lernen können?
Latzel: Die rheinische Kirche ist für mich persönlich die vierte Landeskirche, in der ich tätig bin. Von anderen zu lernen, ist mir sehr wichtig - und selbstverständlich in einer so weltoffenen und plural aufgestellten Kirche wie unserer. Dazu zählt auch das ökumenische Lernen von anderen. In Frankreich lernt man durch die dortige Laizität den Schatz unseres Religionsunterrichts ganz anders kennen. Die finnische Kirche bietet eine sehr gute Lebensbegleitung von Menschen, gerade auch bei jungen Menschen. In Großbritannien habe ich gelernt, wie Sozialraumorientierung auch in sozialen Brennpunkten aussehen kann, in den Niederlanden, wie eine innovative Pionierkultur entsteht und klar profilierte Gemeinden funktionieren.
Von Religionssoziologen wissen wir, dass viele Leute nichts gegen Kirche haben. Trotzdem gehen sie sonntags nicht in die Kirche, sondern verbringen ihre Freizeit lieber anders. Wie können Kirche und Glaube für solche Menschen wieder relevant werden?
Latzel: Indifferenz ist in der Tat ein Problem. Oft beruht sie auf Unkenntnis dessen, was Gemeinden alles leisten. Viele Menschen haben ein sehr traditionell-klischeehaftes Bild von Kirche mit einem Sonntagsgottesdienst in einer spärlich besetzten Kirche um zehn Uhr. Gospel-Chöre, Jugendarbeit, digitale Kirche, diakonische Projekte und vieles andere kommt gar nicht in den Blick. Oder etwa der wichtige Bereich Seelsorge, in dem Menschen spüren: Da ist jemand, der hat Zeit, Ohr und Herz für mich, der kümmert sich um mich.
Etwa in der Telefonseelsorge: Beim Psychotherapeuten steht man oft monatelang auf der Warteliste, Seelsorgerinnen und Seelsorger sind unmittelbar erreichbar. Wenn wir junge Leute erreichen wollen, müssen wir dorthin gehen, wo sie sind. Das ist besonders die Schule. Da haben wir nicht nur Kontaktmöglichkeiten über den Religionsunterricht, sondern auch über Jugendarbeit und Schulseelsorge.
Viele Menschen haben nicht mehr das Grundwissen über kirchliche Angebote und wissen nicht, was manche kirchlichen Elemente bedeuten. Wie können Sie dieses Wissen wieder aufbauen?
Latzel: Wir brauchen zum einen den persönlichen Kontakt von Mensch zu Mensch. Wir müssen Menschen aufsuchen und mit ihnen ins Gespräch kommen. In der Politik erleben wir das gerade im Haustürwahlkampf. Zum anderen sollten wir auch die sozialen Medien weiter verstärkt nutzen. Wenn ich eine schöne Predigt gehalten habe, waren vielleicht 150, 200 Menschen vor Ort. Wenn ich diese online poste, erreiche ich vielleicht zusätzlich 1.000 weitere Personen. Die Digitalisierung bietet Raum für ganz neue kirchliche Vernetzungen.
Wichtiger ist auch der Bereich von Familie und Kindern: Die Menschen haben beispielsweise ein großes Vertrauen in evangelische Kitas. Die Nachfrage ist groß. Wie können wir diakonische und kirchliche Tätigkeit hier stärker vernetzen? Menschen müssen erfahren, dass das alles ein Teil von Kirche ist. Dabei spielen auch mediale Bilder von Kirche eine Rolle. Ich staune immer, wenn in Medien regelmäßig leere Kirchen mit älteren Pastoren zu sehen sind. Die junge Pfarrerin oder die queere Community kommen da nicht vor. Unsere rheinische Kirche ist lebendig, quirlig, bunt - Gott sei Dank.