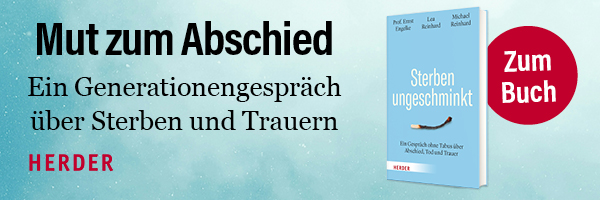Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa und damit die NS-Diktatur. "Das lange Ende des Zweiten Weltkriegs zog sich über die Berliner Luftbrücke im Jahr 1948, die Gründung der Montanunion im Jahr 1952, den Budapester Aufstand 1956, den Mauerbau von 1961, den Prager Frühling 1968, bis zum Fall des Eisernen Vorhangs 1989", hieß es weiter. Auch die "größte Errungenschaft nach Kriegsende", die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, sei politisch instrumentalisiert worden: "Wiederum entschieden nicht die gleichen Rechte jeder Person an jedem Ort, sondern politische Mächte darüber, wer in Frieden und Freiheit leben durfte, und wem dieses Leben verwehrt bzw. vorgetäuscht blieb."
Das Präsidium der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) fordert eine ehrliche, differenzierte Erinnerungskultur. Diese müsse Versöhnung ermöglichen. Krieg und Unrecht dürften nicht politisch instrumentalisiert werden und neue Spaltungen zur Folge haben. Schuld dürfe nicht banalisiert und Menschenrechte nicht relativiert werden, hieß es weiter.
Auch Freund-Feind-Logiken, die in Zynismus endeten, dürften keinen Platz haben. Angesichts aktueller Bedrohungen wie dem Krieg in der Ukraine und autoritären Tendenzen ruft das GEKE-Präsidium dazu auf, die Erinnerung wachzuhalten und aktiv für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenwürde einzutreten - getragen von christlicher Hoffnung.
Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa wurde 1973 gegründet, damals noch unter dem Namen "Leuenberger Kirchengemeinschaft". Mit der Verabschiedung der Erklärung auf dem Leuenberg bei Basel wurde eine seit der Reformation im 16. Jahrhundert bestehende, mehr als 450 Jahre währende Trennung innerhalb der evangelischen Kirchen beendet.
Der Kirchengemeinschaft gehören heute fast 100 lutherische, methodistische, reformierte und unierte Kirchen aus mehr als 30 Ländern in Europa und Lateinamerika an. Damit vertritt der Dachverband nach eigenen Angaben rund 40 Millionen Protestanten.