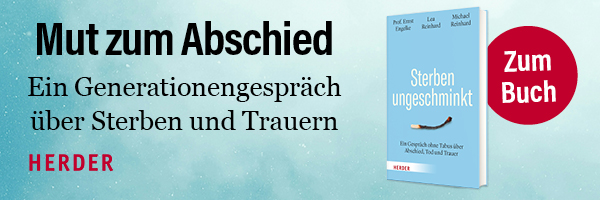Er wollte die Rolle der Ehrenamtlichen stärken und die Kluft zwischen Pastoren und Laien in der Kirche überwinden: Mit dieser Haltung wurde Reinold von Thadden-Trieglaff (1891-1976), ein aus Pommern stammender Jurist und Landwirt, vor 76 Jahren zum geistigen Vater des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Der adelige Gutsbesitzer, der 1945 durch die Abtrennung der deutschen Ostgebiete seinen Besitz verloren hatte, begründete das Protestantentreffen 1949 in Hannover als unabhängige Bewegung evangelischer Laien.
"Auf die Teilnahme des Laienelements am Schicksal der Kirche kommt alles an", schrieb er schon 1935. Eine Idee mit Folgen: 37 weitere Male ist der Kirchentag seit 1949 zusammengekommen, davon drei weitere Male in Hannover. Alle zwei Jahre findet er in wechselnden Städten statt. Wenn das fünftägige Großereignis am 30. April in Hannover zum 39. Mal eröffnet wird, werden rund 100.000 Dauerteilnehmer erwartet.
Thadden-Trieglaff war skeptisch gegenüber einer Kirche, die nur von Berufstheologen dominiert wird: "Wird das Laienglied dazu verurteilt, lediglich die passive Stellung des Predigthörers und Abendmahlsgastes einzunehmen, dann werden die Kirchenbänke des Sonntags wieder leer stehen, bis mit der letzten alten Frau das Leben der Kirche der Reformation endgültig zu Grabe getragen sein wird", schrieb er. Viele Menschen sähen die Kirche als eine Art Beerdigungsinstitut an, das sich mehr um die Toten als um die Lebenden kümmere.
Damit wollte Thadden-Trieglaff sich nicht abfinden. Der Kirchentagsgründer war durch seine Familie geprägt von der Frömmigkeit des lutherischen Pietismus. "Sein Anker war der christliche Glaube", sagt die heutige Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund im NDR. Thadden-Trieglaff studierte Jura und promovierte 1920 über den Völkerbund. Danach arbeitete er auf seinen pommerschen Landgütern, trat der nationalkonservativen DNVP bei und nahm zahlreiche kirchliche Ehrenämter wahr. Im September 1932 veranstaltete er einen regionalen Kirchentag für Pommern in Stettin (heute Szczecin) mit rund 20.000 Besuchern.
Gegen die Gleichschaltung der Kirche
1934 gehörte er zu den Unterzeichnern der Barmer Theologischen Erklärung, mit der sich die oppositionelle "Bekennende Kirche" gegen die Gleichschaltung der evangelischen Kirche durch die Nazis wehrte. Im Sommer 1937 saß er mehrere Wochen in Gestapo-Haft. Dennoch wurde er 1940 zur Wehrmacht einberufen und geriet kurz vor Kriegsende in sowjetische Kriegsgefangenschaft.
Nach dem Krieg war er in Genf für die Ökumene der Kirchen tätig.
Weltweit vernetzt und mit Studenten im Austausch, bedrückte ihn damals die anfangs schwache öffentliche Wirkung der neu gegründeten Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). "Mich beschäftigt auf das stärkste die Frage nach der Schaffung eines ganz großen Resonanzbodens für die EKD in Gestalt eines deutschen evangelischen Kirchentages", schrieb er 1949. Ein solches Treffen müsse frei von der Bevormundung durch die verfasste Kirche sein.
Als einer der Ersten ließ sich Landesbischof Hanns Lilje (1899-1977) aus Hannover für die Idee begeistern. So trafen sich im dortigen Kongresszentrum auf Liljes Einladung vom 28. Juli bis zum 1. August 1949 etwa 3.000 bis 7.000 erneuerungswillige Christen aus beiden Teilen Deutschlands unter dem Motto "Kirche in Bewegung", um einen Neuanfang zu wagen. Das Treffen trug damals noch den Namen "Deutsche Evangelische Woche".
Thadden-Trieglaff habe gewollt, "dass die Kirche sich nach der Katastrophe des Nationalsozialismus verändert und erneuert", sagt seine heutige ehrenamtliche Amtsnachfolgerin Anja Siegesmund. Es habe damals Mut gebraucht, um Aufbruch und Gespräch zu wagen. "Schweigen und Schuld lasteten schwer auf Kirchen und Gesellschaft." Doch Thadden-Trieglaff sei überzeugt gewesen, dass Gott jeden Menschen in die Verantwortung ruft. "Diesen Kern trägt der Kirchentag heute noch in sich."
Bis heute betont der Kirchentag seine Unabhängigkeit von der verfassten Kirche. Der Trägerverein sei nur seinen Statuten verpflichtet, heißt es. Der einstige Gutsbesitzer wurde von 1949 bis 1964 zum ersten und bisher einzigen hauptamtlichen Kirchentagspräsidenten. Er starb am 10. Oktober 1976 in Fulda, wo der Trägerverein des Kirchentags seinen Sitz hat.