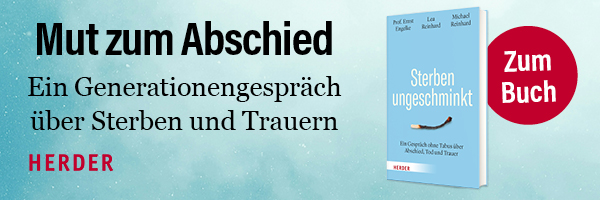Im Interview spricht er über ökumenische Wegmarken, musikalische Verantwortung – und warum jedes Lied für ihn ein Gebet ist.
evangelisch.de: Sie sind seit 25 Jahren auf dem Kirchentag. Wie fühlt sich diese Silberhochzeit für Sie und für die Band an?
Eugen Eckert: Also nicht mehr so aufregend wie das am Anfang war, sondern schon auch routiniert, aber mit einer Vorfreude. Denn der Kirchentag ist das größte protestantische Ereignis im deutschsprachigen Raum und ist immer auch Zeitansage. Insofern bin ich gerne dort und freue mich auch jetzt wieder.
Was meinen Sie mit Zeitansage?
Eckert: Es werden aktuelle Themen aufgegriffen und behandelt. Also jetzt zum Beispiel diese ganze Diskussion um Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin, die ja die Kirchen als eine der NGOs eingereiht hat, und die Frage: Wie positionieren wir uns da und wie relativieren wir auch wieder so eine politische Grundannahme? Natürlich spielt jetzt auch der Tod des Papstes eine Rolle. Das sind die ganz aktuellen Dinge. Und da diese Kirchentage ja seit etlichen Jahrzehnten auch immer mit dem ökumenischen Blick verbunden sind, wird natürlich auch diese Frage – Papst und Papstamt – eine Rolle spielen.
Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Auftritt auf dem Kirchentag? Was ist Ihnen davon noch im Gedächtnis geblieben?
Eckert: Also erst mal der Schock. Es war in Berlin, im Sommergarten 1977, und der Schock bestand darin, dass wir das Gelände nicht befahren durften. Wir hatten einen VW-Bus voller Anlage dabei, eine sehr schwere, selbstgebastelte Orgel, ein sehr schweres Tonkabinett. Dann wurde uns damals gesagt: "Da gibt es Einkaufswagen, da muss man das draufladen und dann sein Instrumentarium aufs Gelände schicken." Damit hatten wir nicht gerechnet. Und das ist ja eine Bodybuilderarbeit – bevor man Musik überhaupt machen kann, wird man zum Möbelpacker.
Dann war das aber eine ganz tolle Sache. Wir sind damals von Martin Jürgens zum Kirchentag vermittelt worden. Er war Stadtjugendpfarrer in Frankfurt – das ist der Mann, der Pfingstmontag 1983 beim Flugzeugabsturz des Starfighters an der Landstraße mit seiner ganzen Familie ums Leben kam. Martin Jürgens war damals Stadtjugendpfarrer, und wir waren die Band des Frankfurter Stadtjugendpfarramts, die dort aufgetreten ist. Also insofern kann ich mich an die Ereignisse sehr genau erinnern.
Gab es denn in diesen 25 Jahren ein besonders bewegendes oder denkwürdiges Erlebnis auf dem Kirchentag?
Eckert: Das denkwürdigste Erlebnis war, dass ich mit meiner Frau am Karfreitag 2003 noch in Hamburg gewesen bin und mich mit Dorothee Sölle und ihrem Mann Fulbert Steffensky getroffen habe. Wir hatten eine ganze Reihe von gemeinsamen Veranstaltungen für den ersten Ökumenischen Kirchentag, der 2003 in Berlin stattfand, geplant. Dorothee sang im Chor. Wir haben zusammen zu Mittag gegessen. Sie hat dann Mittagsschlaf gemacht, und dann haben wir die Veranstaltung geplant und geredet – und vier Wochen später war Dorothee Sölle tot. Damit fielen im Prinzip alle Veranstaltungen, die wir geplant hatten, aus.
Einerseits die Traurigkeit und Betroffenheit über den Tod dieser wunderbaren Frau – und dann das Wunder: Der damalige Bischof Wolfgang Huber hat gesagt: "Eugen, ich springe ein. Das können wir nicht machen. Die Programmhefte sind gedruckt, die Menschen werden kommen, und die Veranstaltung muss stattfinden können." Also hat er die sprechende Rolle übernommen und wir haben wie geplant Musik gemacht. Das war natürlich grandios.
"Beherzt zu handeln heißt für uns: mit Zivilcourage auftreten, Dinge beim Namen nennen, sich klar positionieren und sich einsetzen können"
Wie hat sich denn Ihr musikalischer Stil oder Ihr Auftreten über die Jahre verändert? Ist die Botschaft gleich geblieben?
Eckert: Das sind eigentlich zwei Fragen. Also der musikalische Stil hat sich deutlich professionalisiert im Laufe der Jahrzehnte. Die erste Besetzung war der Preisträger bei "Jugend musiziert" an der Gitarre – der war unser musikalischer Kopf. Als sich 1985 ein Wechsel in der Band anbahnte, hatten wir das große Glück, Leute kennenzulernen – Pianisten, später auch Gitarristen, die beide an der Musikhochschule in Frankfurt waren. Das hat das Niveau deutlich nach oben gehoben. Inzwischen sind es lauter Profis, die auch in anderen Formationen spielen – etwa beim Grüne Soße Festival in Frankfurt oder bei Musicals in Bad Hersfeld.
Was die Botschaft betrifft: Wir haben uns bewusst nach dem biblischen Propheten Habakuk benannt – einem kleinen Sozialpropheten, der einerseits klagt über eine Gesellschaft, in der die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, und andererseits eine Vision entwickelt, wie man gut gesellschaftlich leben könnte. Das ist die Botschaft, die wir vertreten. Die großen Themen wie Bewahrung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit spielen durchgehend eine Rolle. Natürlich ändern sich die gesellschaftlichen Kontexte, aber sie sind miteinander verknüpft – etwa Ökologie, Migration, Gerechtigkeit und Frieden. Die Probleme verändern sich – leider nicht nur zum Guten – aber unsere Botschaft bleibt im Kern gleich.
Was bedeutet das diesjährige Motto "Mutig, stark, beherzt" für Sie als Musiker?
Eckert: Für uns ist das ein tolles Motiv. Wir haben auch ein sehr schönes Lied dazu geschrieben. "Beherzt" ist im Grunde eine andere Lesart von "mutig". Beherzt zu handeln heißt für uns: mit Zivilcourage auftreten, Dinge beim Namen nennen, sich klar positionieren und sich einsetzen können. Das war für uns immer Standard. Dieses Motto bestärkt uns in dem, was wir tun.
"Ich komme stark aus der sozialgeschichtlichen, feministischen und Befreiungstheologie – inspiriert durch Frauen wie Dorothee Sölle oder Luise Schottroff"
Spüren Sie eine besondere Verantwortung, wenn Sie vor einem Kirchentags-Publikum spielen?
Eckert: Ja, in jedem Fall. Ich weiß aus der Tradition, dass Musik auch missbraucht worden ist. Die Nazis haben zum Beispiel die Wandervogelbewegung und deren Lieder für ihre Zwecke instrumentalisiert, auch christliche Lieder. Das hat dazu geführt, dass nach dem Krieg mindestens eine Generation ungern gesungen hat, weil sie sich vorgeführt gefühlt hat. Dabei ist Singen etwas zutiefst Gemeinschaftsbildendes. Musik ist elementar wichtig – für menschliche Entwicklung, für Transzendenz, für Gemeinschaft. Und wenn man das weiß, dann muss man sehr sensibel damit umgehen, welche Emotionen man mit Musik auslöst. Das heißt nicht, dass wir keine Partystimmung machen – aber wir versuchen, den inhaltlichen Bogen so zu schlagen, dass das Denken nicht ausgesetzt wird. Denkende Menschen sollen nicht aufhören zu denken.
Wie hat sich denn das Publikum auf dem Kirchentag über die Jahre verändert? Oder ist das eher eine konstante Größe?
Eckert: Mein Verdacht war zwischenzeitlich, dass das Publikum älter geworden ist – wie ich selbst auch. Aber es sind immer noch viele junge Menschen dabei, etwa Pfadfindergruppen. Viele nehmen das Gemeinschaftsquartier in Kauf und zelebrieren das als Event. Mit 30 Leuten in eine U-Bahn steigen und einfach mal loszusingen – das kennt man sonst nur vom Fußball. Eine Stadt friedlich für ein paar Tage zu "erobern" – das ist eigentlich schön. Und mein Eindruck ist: Gerade jetzt sind wieder viele junge Leute auf der Suche und offen für die Erfahrung eines Kirchentags. Das war auch vor 50 Jahren so.
Gibt es einen Moment, auf den Sie sich immer wieder besonders freuen?
Eckert: Was immer sehr schön ist: Man steht vor einer Reise – etwa von Frankfurt nach Hannover – und fragt sich: Habe ich alles dabei? Wird alles klappen? Wenn dann die Anlage auf der Bühne steht, der Soundcheck erfolgreich war, und alle das Gefühl haben, dass es gut werden kann – und es dann tatsächlich gut wird – dann ist dieser Moment erreicht.
Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem Leben als Musiker?
Eckert: Für mich ist jedes Lied ein gesungenes Gebet. Augustinus wird ja der Satz zugeschrieben: "Wer singt, betet doppelt." Ich bin der Texter in der Band – für mich ist das eine zentrale Möglichkeit, Glauben auszudrücken, zu formulieren und weiterzugeben. Ich komme stark aus der sozialgeschichtlichen, feministischen und Befreiungstheologie – inspiriert durch Frauen wie Dorothee Sölle oder Luise Schottroff. Ich versuche eine Sprache zu finden, die nicht patriarchal geprägt ist – die weiß, dass Gott viele schöne Namen hat: nicht nur Vater und Herr, sondern auch Mutter, Glucke, Liebe. Ich suche Begriffe, die über das traditionelle Liedgut hinausgehen. Diese kreative Auseinandersetzung mit Glauben – neue Lieder, neue Sprache, neue Reaktionen – ist eine spannende Erfahrung. Und sie hat natürlich immer mit dem eigenen Glauben zu tun.
Beim Bearbeiten dieses Beitrags wurde die KI Chat GPT als unterstützendes Werkzeug eingesetzt (die Form betreffend).