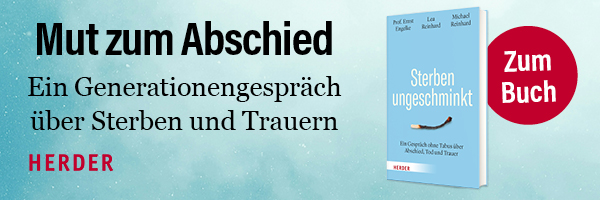Trier (epd). Der Trierer Soziologe Michael Jäckel beobachtet einen Wandel des Konsumverhaltens in der Gesellschaft. „Das Umfeld des Konsumierens hat sich seit Corona verändert“, sagte der Professor für Soziologie an der Universität Trier dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der ständige Krisen-Modus wirke sich auf die Konsumorte aus, die Innenstädte verlören an Attraktivität. Nachhaltigkeit sei zentral geworden. Aber trotz mehr Angeboten in diesem Bereich bleibe das schnelle Kommen und Gehen von Produkten zu rätselhaften Preisen bestehen.
Jäckel versteht die Konsumgeschichte als Episoden eines sich wandelnden Systems von Bedürfnissen und Ansprüchen. Im 18. Jahrhundert habe der „consumer“ noch keine wirkliche Rolle gespielt. Erst im 19. Jahrhundert sei der Konsument im heutigen Sinne durch den Wandel von der Agrar- zur Industriegesellschaft auf die Bühne getreten, so der Autor des Buches „Konsum - eine Abrechnung“. Und damit waren auch Kosten- und Nutzenüberlegungen in der Welt. So stellte der Statistiker Ernst Engel im 19. Jahrhundert fest, dass mit steigendem Einkommen der Anteil für Ernährungsausgaben sinkt - ein Indikator für soziale Ungleichheit: „Wer wenig hat, muss also auch mehr rechnen.“
Der „homo oeconomicus“ sei ein Modell für Menschen, die immer das Beste für sich herausholen wollten, sagte Jäckel: „Aber es geht eben nicht nur um elementare Bedürfnisse, sondern vermehrt um Phänomene, die dem Modewandel unterliegen.“ Eine Mischung aus persönlichen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und die ständige Debatte darüber, was gerade angesagt ist oder nicht, würden eine Dynamik schaffen, die weit mehr umfasse als bloßes Einkaufen zum täglichen Bedarf. So werde im Bereich Bekleidung regelmäßig danach gefragt, wie viele Teile man denn besitze und auch regelmäßig nutze: „Stets stellt man fest, dass oft mehr im Warenkorb und Kleiderschrank landet, als wirklich gebraucht wird.“
Auf dem sehr wechselhaften Influencer-Markt gehe es darum, für eine bestimmte Idee oder ein Produkt möglichst viele Anhänger zu finden. Dort, wo der Kreislauf auf Beschleunigung setzt, machten Gegenbewegungen auf sich aufmerksam, die die Bedeutung des Konsums zugleich moralisch aufwerten. Beispiele seien Second Hand-Läden oder Upcycling-Konzepte, auch Repair-Cafés, die auf Produktverlängerung und Produktrettung setzen, um den Wirtschaftskreislauf anders zu gestalten.
Eine totale Konsumverweigerung sei angesichts der Vielfalt von alternativen Vorschlägen schwierig, räumte Jäckel ein. Ein erstaunliches Phänomen der Moderne sei, dass gerade in Zeiten des Überflusses so viele Menschen über die Grundlagen des einfachen Lebens nachdenken. Das nehme gelegentlich auch paradoxe Formen an, etwa, wenn Verzicht und Entsagung selbst einen Marktwert erhalten. Wer sich dabei gut positioniert, ist dann vielleicht auch noch interessant für eine Talkshow, sagt Jäckel: „Zurecht wurde daher sinngemäß gefragt: Wie kann es also sein, dass so viele Menschen die Konsumgesellschaft verteufeln und trotzdem in einer solchen leben?“