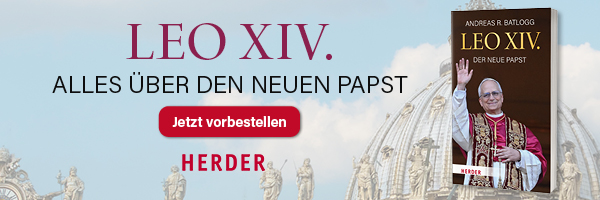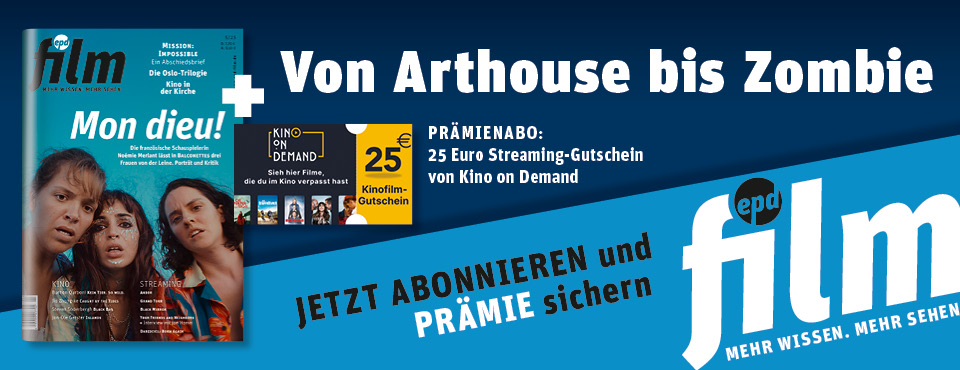In Stuttgart entfaltet sich derzeit eine faszinierende Reise durch die Welt der Heiligen Schrift. Unter dem Titel "Gottes Wort für alle Welt!? - Bibeln und Mission im kolonialen Kontext" zeigt die Württembergische Landesbibliothek (WLB) bis zum 14. Juni Bibeln aus aller Welt. Die Ausstellungsstücke stammen aus der hauseigenen Sammlung, die mit 22.000 Bänden in 800 Sprachen die drittgrößte Bibelsammlung der Welt und mit Blick auf deutsche Bibeln sogar die größte überhaupt ist.
"Die Bibeln waren in vielen Ländern die ersten gedruckten Bücher in der eigenen Sprache", sagt Kurator Christian Herrmann. So zeigt die Ausstellung die ältesten Bibeldrucke aus allen Kontinenten: Eine der 49 noch erhaltenen Exemplare der Gutenberg-Bibel (zwischen 1452 und 1454), die erste Druckausgabe der Bibel, ebenso wie beispielsweise auch eine "Bibel für betende Indianer" (1663), die der englische Missionar John Eliot (1604-1690) in die Algonkin-Sprache übersetzte und die der älteste Bibeldruck des amerikanischen Kontinents ist.
Laut Zahlen der Bibelgesellschaft gab es 2023 eine vollständig übersetzte Bibel in 743 Sprachen - schätzungsweise 80,5 Prozent der Menschen weltweit wurden dadurch in ihrer Muttersprache erreicht. "Dies legt nahe: Der christliche Glaube ist ohne die Bibel, ist ohne das Lesen und Hören der biblischen Texte - und zwar möglichst in der je eigenen Sprache - nicht denkbar", sagt Herrmann. "Ohne den Eifer und die Hoffnung der missionarisch aktiven Christen wäre die Bibel nicht das meistgedruckte und meistübersetzte Buch der Welt."
Die Ausstellung zeigt auch klar, dass Missionare trotz ihres Wunsches "alle Welt zu erreichen", dennoch nicht mit den Kolonialmächten per se gleichzusetzen sind. So versetzten sich viele Missionare für ihre Übersetzungen intensiv in die Lebens- und Gedankenwelt ihres Gegenübers. Albert Ruyl, ein Kaufmann, der für die niederländische Ostindien-Gesellschaft tätig war, übersetzte das Matthäusevangelium ins Malaiische. Da es im Malaiischen Archipel keinen Feigenbaum gab, wandelte er ihn in einen Bananenbaum um. Aus dem Wolf, der dort ebenfalls nicht existierte, wurde ein Tiger.
Christentum wurde als Bereicherung gesehen
Bewusst verwendete Ruyl auch den arabischen Begriff "Allah" für Gott, weil dieser arabische Begriff im Malaiischen als Bezeichnung für Gott allgemein gebräuchlich war. "Bis heute steht in den indonesischen und malaysischen Bibeln dieser Begriff für Gott, was für Diskussionen sorgt, da manche christlichen ebenso wie muslimischen Gruppen dies ablehnen, da sie 'Allah' mit dem Gott des Korans konnotieren", erklärt Herrmann.
Bartholomäus Ziegenbalg (1638-1719) sammelte über hundert hinduistische Palmblatthandschriften zur Erforschung der tamilischen Kultur. Und er verfasste selbst auf Palmblättern eine Vorstellung des dreieinigen Gottes und ließ diese "Traktate" in das Landesinnere Indiens schicken. Eine dieser missionarischen Schriften auf Palmblättern in Form eines Fächers ist in der Ausstellung zu sehen.
Die Missionare waren Kinder ihrer Zeit: So kam es oft vor, dass Afrikaner, die Christen wurden, sich wie Europäer kleiden sollten und europäisches Liedgut sangen. "Doch meist wurde das Christentum heimisch in der Zielkultur und wurde als Bereicherung angesehen", so Herrmann, der Leiter der Sammlung Alte und Wertvolle Drucke der WLB ist. Einige Missionare trugen auch zur Völkerverständigung bei, indem sie Grammatiken und Wörterbücher erstellten, wie zum Beispiel die erste gedruckte Grammatik aus dem Jahr 1806 in Sanskrit des britischen Baptisten William Carey - ein Schlüssel zur indischen Hochkultur.
Oder das sechsbändige chinesisch-englische Wörterbuch, das der Missionar Robert Morrison (1782-1834) verfasste. Es gab auch Fälle, in denen Missionare aktiv Sklaverei bekämpften oder sich gegen den Import von Alkohol stellten und dadurch sogar zu Gegnern der kolonialen Mächte wurden, wie die Ausstellung zeigt. Bibeln in der Muttersprache wurden meistens nicht als Fremdkörper aufgefasst, sondern bewirkten im Gegenteil oft Neugier und Dankbarkeit. Das ist an einem kuriosen Beispiel zu sehen: So bedankten sich die Inuit-Gemeinden bei der britischen Bibelgesellschaft für die Übersetzung der Evangelien im Jahr 1813 in den Labrador-Dialekt der Eskimo-Sprachen mit einem Fass Seehundtran.