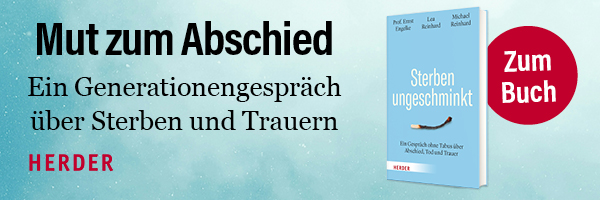evangelisch.de: Frau Pannrucker, ihre Diakonie betreut einige Freiwillige mit Fluchterfahrung. Wer darf das machen? Wie ist der Ablauf?
Carry Pannrucker: Grundsätzlich ist der Freiwilligendienst offen für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft. Das Bundesfreiwilligendienstprogramm bieten wir auch Geflüchteten an, egal welchen Aufenthaltsstatus sie haben. Das Mindestalter ist 16 Jahre. Wir haben auch ein Ü27-Programm für Menschen über 27 Jahre. Auch hier betreuen wir Freiwillige mit Fluchterfahrung.
Nach ihrem Volontariat in der Pressestelle der Aktion Mensch arbeitete Alexandra Barone als freie Redakteurin für Radio- und Print-Medien und als Kreativautorin für die Unternehmensberatung Deloitte. Aus Rom berichtete sie als Auslandskorrespondentin für Associated Press und für verschiedene deutsche Radiosender. Seit Januar 2024 ist sie als Redakteurin vom Dienst für evangelisch.de tätig.
Voraussetzung ist, dass sie eine Beschäftigungserlaubnis der Ausländerbehörde mitbringen. Bei dieser bürokratischen Hürde beraten wir. Auch Grundkenntnisse in Deutsch sollten vorhanden sein, aber wir schauen danach auch im persönlichen Gespräch. Wichtig ist die Bereitschaft, sich für eine gewisse Zeit zu engagieren - in der Regel sind das zwölf Monate.
Somit ist die Freiwilligenarbeit eine gute Möglichkeit für Flüchtlinge, in Deutschland Fuß zu fassen?
Pannrucker: Wir sagen, auf jeden Fall! Der Freiwilligendienst bietet eine Möglichkeit, sehr niedrigschwellig Zugang zum Leben und Arbeiten in Deutschland zu bekommen. Die Freiwilligen sind in unterschiedlichen sozialen Bereichen aktiv: in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten, Kirchengemeinden und Schulen.
"Sie gestalten die Gesellschaft aktiv mit und erfahren, dass ihre Arbeit wichtig ist und sie einen Platz in Deutschland haben."
So bekommen sie nicht nur sehr schnell Einblicke in die Arbeitswelt in Deutschland, sondern können auch ihren Spracherwerb verbessern. In der Regel passiert das sehr schnell - im Austausch mit den Kollegen vor Ort, aber auch in den Seminaren mit anderen Freiwilligen, die sie dort kennenlernen.
Im täglichen Miteinander mit Patienten, älteren Menschen, Kindern oder anderen Zielgruppen gestalten sie die Gesellschaft aktiv mit und erfahren, dass ihre Arbeit wichtig ist und sie einen Platz in Deutschland haben. Das Schöne an den Freiwilligendiensten ist auch, dass keinerlei Vorkenntnisse oder Vorerfahrungen notwendig sind. Alle bekommen die Möglichkeit, sich in einem beruflichen Feld auszuprobieren und etwas Neues zu lernen.
Die damalige CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte 2018 den Vorschlag gemacht, ein verpflichtendes soziales Dienstjahr für Flüchtlinge in Deutschland einzuführen. Was sagen Sie dazu?
Pannrucker: Ich finde die Umsetzung dieser Idee schwierig, da hiermit der Sinn des Freiwilligendienstes verloren gehen würde. Es geht um Freiwilligkeit! Die Geflüchteten, die sich engagieren, wollen etwas für die Gesellschaft tun und bringen eine hohe Motivation mit. Oft können sie sich vorstellen, später im sozialen Bereich zu arbeiten.
"Bei einem verpflichtenden Dienst besteht meiner Meinung nach die Gefahr, Menschen zu beschäftigen, die keinen Zugang zu ihrer Arbeit finden."
Mit einem verpflichtenden Dienstjahr würde der gewisse Spirit verloren gehen, der den Freiwilligendienst trägt und der davon lebt, dass Menschen sich gerne für andere engagieren. Bei einem verpflichtenden Dienst besteht meiner Meinung nach die Gefahr, Menschen zu beschäftigen, die keinen Zugang zu ihrer Arbeit finden. Nicht alle können sich vorstellen, ältere Menschen in einem Pflegeheim bei ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten. Es muss eine Bereitschaft vorhanden sein, mit diesen Zielgruppen zu arbeiten.
Welche Erfahrungen haben Sie in den vergangenen zehn Jahren gesammelt? Was hat sich seit 2015, dem "Sommer der Migration", geändert?
Pannrucker: Das Programm des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) für Menschen mit Fluchterfahrung wurde 2015 ins Leben gerufen. Es wurde sehr gut angenommen, es gab viele Geflüchtete, die sich gemeldet haben und einen Freiwilligendienst machen wollten. Damals machten wir viel Werbung in den Netzwerken der Diakonie und der Kirche. Auch mit Beratungsstellen haben wir eng zusammengearbeitet, die dann weitervermittelt haben.
Das Programm wurde zum Selbstläufer und verbreitete sich in der Folge vor allem über Mund-zu-Mund-Propaganda. Zu uns kamen in erster Linie junge Menschen, die gerade nach Deutschland gekommen waren und kaum Deutsch sprachen. Sie standen zudem auch erst am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn. Das ist in der Zwischenzeit anders. Das "Sonderprogramm Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug" gibt es nicht mehr. Es fehlte der politische Wille, das Programm zu verstetigen.
"Aktuell haben wir eher ältere Geflüchtete, die sich bei uns melden."
Nach 2015 kamen insgesamt weniger Geflüchtete nach Deutschland. Das spiegelt sich auch in unseren Zahlen wider – wir betreuen weit weniger Freiwillige mit Fluchterfahrung. Aktuell haben wir eher ältere Geflüchtete, die sich bei uns melden. Sie bringen viel Lebenserfahrung mit und haben in der Regel schon eine Berufsausbildung in ihrem Heimatland abgeschlossen. Sie sind zum Teil hoch qualifiziert und bringen bereits sehr gute Deutschkenntnisse mit.
Aber gerade 2022/23 gab es eine enorme Flüchtlingswelle, über eine Million Menschen aus der Ukraine sind nach Deutschland geflohen. Gab es da nochmal einen Zuwachs an Nachfragen seitens der Geflüchteten oder hat der Freiwilligendienst bei der ukrainischen Bevölkerung wenig Interesse geweckt?
Pannrucker: Wir haben zwar auch ukrainische Menschen im Programm, aber eine starke Nachfrage bestand nicht. Viele ukrainische Geflüchtete bekamen durch den Sonderstatus, den Deutschland ihnen verlieh, eine Arbeitserlaubnis. So konnten sie direkt in den Arbeitsmarkt eintreten und Geld verdienen.
"Viele ukrainische Geflüchtete bekamen durch den Sonderstatus, den Deutschland ihnen verlieh, eine Arbeitserlaubnis. So konnten sie direkt in den Arbeitsmarkt eintreten."
Die ukrainischen Freiwilligen, die wir aktuell betreuen, verstehen den Freiwilligendienst als Möglichkeit, die deutsche Arbeitswelt kennenzulernen, die Sprache zu verbessern und ihr Netzwerk auszubauen.
Laut Statistikamt haben sich die Zahlen an Migranten wieder "normalisiert" – die Rede ist von 400.000 bis 600.000 Einwanderern pro Jahr. Einige Ihrer Kollegen haben die Arbeit eingestellt – teils auch, weil es keine Gelder mehr gibt. Ihre Diakonie macht allerdings weiter…
Pannrucker: Ja, wir haben unabhängig von der Förderung weitergemacht. Uns ist die Weiterführung dieses Angebots ein Anliegen, da wir darin einen großen Mehrwert sehen. Zum einen sind die Einsatzstellen dankbar für die hohe Motivation und die vielfältigen Erfahrungen, mit denen die Freiwilligen die Teams vor Ort bereichern. Insbesondere in der Pflege nehmen sie den Fachkräften eine enorme Arbeitslast von den Schultern, indem sie zusätzliche Hilfstätigkeiten übernehmen. Zum anderen sehen wir den Mehrwert für die Geflüchteten selbst.
Viele Einsatzstellen übernehmen die Freiwilligen danach in die Ausbildung. Durch die Freiwilligenarbeit werden sie ein Teil der deutschen Gesellschaft, sie lernen Kultur und Sprache und erhalten eine konkrete Bleibeperspektive. Wir wünschen uns für die Zukunft wieder die politische Bereitschaft, Geflüchteten mit konkreten Unterstützungsangeboten den Zugang zum Leben in Deutschland zu erleichtern. Als Gesellschaft sind wir auf Menschen aus dem Ausland angewiesen. Diese Menschen sind in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung für uns. Auch angesichts der aktuellen Stimmung in Deutschland wünschen wir uns, dass die Politik diesen Weg wieder einschlägt.