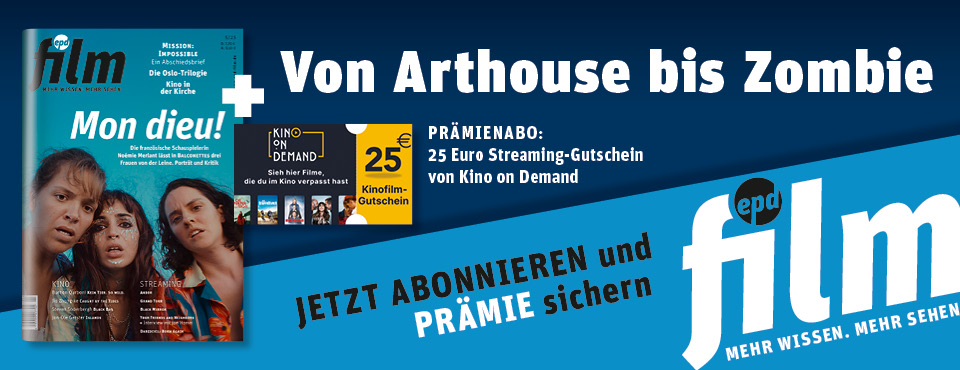Für mich geht es beim Dialog zwischen den Generationen um gegenseitiges Lernen. Dieser Dialog ist keine Einbahnstraße, bei der die älteren Generationen den jüngeren Lektionen erteilen, und auch nicht umgekehrt. Stattdessen ist es ein gemeinsames Unterfangen auf Augenhöhe, bei dem jede Generation zuhört, lernt und gemeinsam wächst. Das ermöglicht es uns, die Perspektiven, Werte, Verhaltensweisen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der jeweils anderen Generation zu verstehen.
Es geht darum, die Vielfalt – nicht nur des Alters, sondern auch der Ansichten – zu akzeptieren und gleichzeitig die Gemeinsamkeiten zu erkennen, die uns verbinden. Nur so können wir effektiv aus der Vergangenheit lernen und gemeinsam eine Zukunft gestalten, die gerecht und nachhaltig ist.
Für mich stellt der intergenerationale Dialog ein Instrument dar, was unsere derzeitige Gesellschaft, und auch die Kirche dringend braucht. Ich möchte hier vor allem darüber schreiben, wie aus meiner Perspektive ein erfolgreicher Dialog der Generationen gelingen kann. Dabei beziehe ich mich auf meine Erfahrungen der letzten Jahre, als junge Person in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), im Verband der Evangelischen Studierendengemeinden in Deutschland und und als Vorsitzende von des Weltverbandes christlicher Studierendengemeinden in Europa (WSCF-Europe) aktiv zu sein.
Wenn wir es ernst meinen mit der Bewältigung der drängendsten Herausforderungen in Europa – Klimawandel, Verteidigung der Demokratie, Bekämpfung des Extremismus und Schutz der Freiheiten – müssen wir junge Menschen als gleichberechtigte Partner:innen behandeln. Für mich bedeutet gleichberechtigte Beteiligung mehr, als junge Menschen gelegentlich zu konsultieren oder sie zur Beobachtung von Entscheidungsprozessen einzuladen. Es bedeutet, sie in diese Prozesse als Mitwirkende einzubeziehen, deren Stimmen die Lösungen aktiv gestalten.
Die europäische Jugendorganisation WSCF-Europe geht nach diesem Grundsatz vor und versucht, sich auf die Zusammenarbeit zwischen den Generationen zu konzentrieren, um aktuelle Krisen zu bewältigen. Ein Projekt aus dem letzten Jahr, das ich besonders hervorheben möchte, beschäftigte sich mit dem Thema "Generationenübergreifende Umweltgerechtigkeit". Zentral war hierbei, Menschen aller Altersgruppen zusammenzubringen, um ökologische Herausforderungen anzugehen, und ein Toolkit für Advocacy-Strategien zu entwickeln, das die Stärken der verschiedenen Generationen einbezieht. Einige der Ideen, die ich hier erwähne, stammen direkt aus diesem Projekt.
Jugend gleichberechtigt am Entscheidungstisch
Dieses Prinzip der Zusammenarbeit ist für verschiedenste Institutionen gleichermaßen wichtig. Dabei können Glaubensgemeinschaften und Kirchen, die von Natur aus generationenübergreifende Räume sind, Inklusion vorleben, indem sie die Jugend in die Leitung und Entscheidungsfindung aktiv einbeziehen. Ältere Generationen können trotz ihrer unterschiedlichen Sichtweisen wertvolle Verbündete sein, indem sie Ressourcen, Netzwerke und institutionelles Wissen zur Verfügung stellen, um von Jugendlichen geleitete Initiativen durch Mentor:innenschaft oder logistische Hilfe zu unterstützen.
Auch die Rollen können sich im Laufe der Zeit verändern. Ältere Generationen können sich als Hauptakteur:innen zurückziehen und stattdessen ihre Erfahrungen und Ressourcen nutzen, um jungen Menschen die Führung zu übertragen. Diese Verschiebung schafft Vertrauen und stellt sicher, dass jugendliche Energie und Innovation künftige Lösungen prägen.
Strukturen für sinnvolle Inklusion schaffen
Die Einbindung junger Menschen muss über reine Symbolik hinausgehen. Es reicht nicht, ein oder zwei junge Vertreter*innen einzubinden, da dies nicht die Vielfalt jugendlicher Stimmen widerspiegelt. Stattdessen müssen Systeme geschaffen werden, die sicherstellen, dass junge Menschen von Anfang an einbezogen werden. Diese Strukturen ermöglichen nicht nur, dass junge Menschen gehört werden, sondern dass sie aktiv an der Gestaltung von Kirche und Gesellschaft mitwirken, den Dialog bereichern und gemeinsam mit älteren Generationen Brücken bauen, um Konflikte zu vermeiden.
Kooperationen, wie die zwischen der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) und Jugendorganisationen wie WSCF-Europe, zeigen, wie junge Führungspersönlichkeiten zentrale Rollen bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen einnehmen können. So lud KEK uns kürzlich ein, Methodik und Inhalte für eine Sommerakademie zu Menschenrechten mitzuentwickeln – ein praktisches Beispiel für die Einbindung junger Menschen als Mitgestaltende.
Machtstrukturen hinterfragen
Eine ehrliche Diskussion über intergenerationalen Dialog erfordert die Auseinandersetzung mit Machtstrukturen. Wer trifft die Entscheidungen? Wessen Stimmen fehlen? Wer ist nicht im Raum? Diese Fragen sind entscheidend, um die Barrieren zu verstehen und abzubauen, die einer sinnvollen Zusammenarbeit im Weg stehen. Machtstrukturen zu hinterfragen, spielt auch zunehmend eine Rolle in der EKD. 2022 erfolgte durch die EKD-Synode der Beschluss Anti-Diskriminierung, Gewaltprävention und Diversitätsorientierung zu stärken. Seitdem wird daran gearbeitet, wie das innerhalb der EKD institutionell umgesetzt werden kann. Im Zuge dessen beschloss die Synode 2024, dass die Zusammensetzung der nächsten Synode diverser sein soll und so beispielsweise mit Blick auf People of Color, Menschen aus der LGBTQI*-Community, Menschen mit Behinderung und Menschen, die in Armut gelebt haben oder leben, in die Synode berufen werden sollen.
Wichtig ist, dass diese Reflexion über Machtstrukturen bei uns selbst beginnen muss, in unseren Organisationen und Strukturen, und sich auf die weiteren Systeme ausdehnt, in denen wir arbeiten. Nur durch die kritische Betrachtung von Machtungleichgewichten können Räume geschaffen werden, in denen intergenerationaler Dialog gedeiht und zu bedeutenden Ergebnissen führt.
Brücken bauen für eine gerechtere Zukunft
Mein Engagement für den intergenerationalen Dialog in Kirche und Gesellschaft ist tief in meiner Überzeugung verwurzelt, dass nachhaltige Veränderung nur gemeinsam gelingen kann. Ich habe erlebt, wie bereichernd es ist, wenn unterschiedliche Generationen ihre Erfahrungen, Ideen und Perspektiven teilen – sei es in der EKD-Synode, in internationalen Netzwerken oder in der Arbeit mit jungen Menschen, die selbst Verantwortung übernehmen wollen. Doch ich sehe auch die Herausforderungen: Oft bleiben Entscheidungsprozesse in festen Hierarchien verhaftet, Macht wird ungleich verteilt, und junge Stimmen werden nicht als gleichwertig anerkannt.
Genau hier möchte ich weiterarbeiten – daran, Strukturen zu schaffen, die echte Teilhabe ermöglichen, und daran, Räume zu öffnen, in denen generationsübergreifende Zusammenarbeit nicht nur gewünscht, sondern gelebte Realität ist. Kirche und Gesellschaft stehen vor großen Umbrüchen, und es braucht mutige Schritte, um diese gemeinsam zu gestalten. Ich bin überzeugt: Wenn wir Dialog nicht nur als Austausch, sondern als gemeinsames Handeln verstehen, können wir eine Zukunft formen, die gerechter, inklusiver und widerstandsfähiger ist.
evangelisch.de dankt der Evangelischen Mission Weltweit und mission.de für die inhaltliche Kooperation.