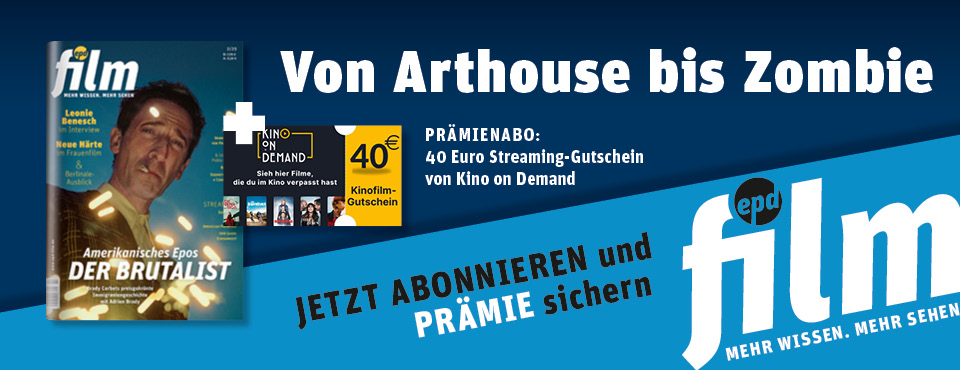Köln (epd). Das gesellschaftliche Miteinander in Deutschland wird laut einer Umfrage zunehmend kritisch bewertet. So fühlen sich 56 Prozent der Befragten in der Gesellschaft zwar angemessen behandelt, wie der am Donnerstag vom WDR veröffentlichte ARD-Deutschland-Trend ergibt. Der Anteil liege aber zehn Prozentpunkte unter dem Wert aus dem April 2018, als diese Frage zum vorerst letzten Mal gestellt wurde. Der Anteil jener, die sich eher benachteiligt fühlen, sei im selben Zeitraum um acht Prozentpunkte auf 24 Prozent gestiegen. Jeder Siebte (14 Prozent) der Befragten fühle sich in der Gesellschaft in Deutschland eher bevorzugt. Dieser Wert liege lediglich einen Punkt unter dem Ergebnis aus dem April 2018.
Für den ARD-Deutschland-Trend hatte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap in dieser Woche mehr als 1.300 volljährige Wahlberechtigte per Telefon oder Internet befragt. Sehr positiv wird den Ergebnissen zufolge das Miteinander im Freundes- und Bekanntenkreis (94 Prozent) sowie in der Familie (92 Prozent) wahrgenommen. Eine deutliche Mehrheit der Befragten (86 Prozent) empfinde zudem das Miteinander am Arbeitsplatz als sehr gut oder eher gut. Das Miteinander in der eigenen Stadt oder Gemeinde bewerteten drei von vier Befragten (74 Prozent) als positiv.
Was das öffentliche Miteinander der Menschen angeht, sind die Befragten hingegen geteilter Meinung: So empfindet laut Umfrage etwa jeder und jede zweite (48 Prozent) das Miteinander beim Einkaufen oder im Straßenverkehr als sehr gut oder eher gut. Fast ebenso viele Befragte (47 Prozent) schätzten das Zusammenleben in diesen Bereichen aber als eher schlecht oder sehr schlecht ein, hieß es.
Ein schlechtes öffentliches Miteinander liegt nach Ansicht von 84 Prozent der Befragten in wirtschaftlichen Sorgen begründet, wie die Umfrage ergibt. Für 80 Prozent der Befragten spiele die Belastung durch Stress und Zeitdruck eine Rolle, 78 Prozent machten eine negative Grundstimmung durch Kriege und Krisen in der Welt dafür verantwortlich. Mehr als drei Viertel (77 Prozent) hielten zudem die Unterschiede zwischen armen und reichen Menschen für ein sehr großes oder großes Problem für das Zusammenleben.