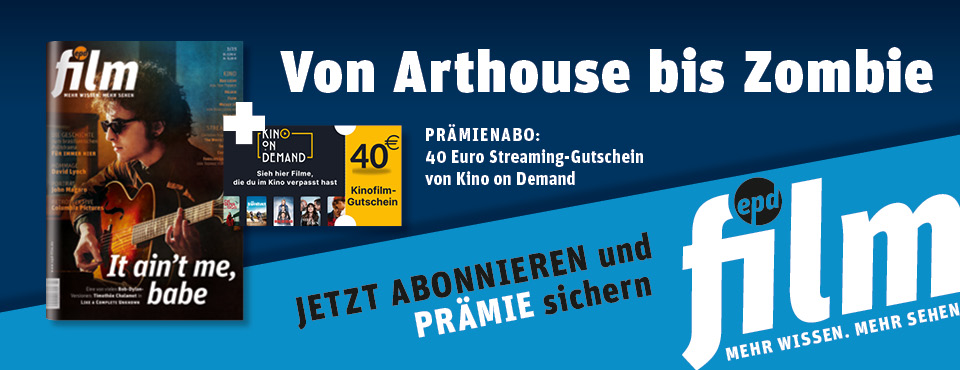Berlin (epd). Nach monatelangem Ringen in der Ampel-Koalition hat das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin die Einführung einer Kindergrundsicherung gebilligt. Der Gesetzentwurf von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sieht vor, dass mit der Kindergrundsicherung das Kindergeld, der Kinderzuschlag für Familien mit wenig Einkommen und Leistungen für Kinder im Bürgergeld und in der Sozialhilfe zusammengefasst werden. Dazu zählen auch Beträge für Schulsachen und Freizeitaktivitäten.
Die Kindergrundsicherung soll zum 1. Januar 2025 eingeführt werden. Kritik kam aus der Verwaltung und von Sozialverbänden. Die SPD drang darauf, den Zeitplan einzuhalten.
Paus bezeichnete die Reform als „eine Antwort auf die Kinderarmut“. Mit der Kindergrundsicherung knüpfe die Ampel-Regierung „ein wirksames Sicherheitsnetz für alle Kinder und ihre Familien“, erklärte sie. Armutsgefährdete Alleinerziehende im Bürgergeld würden bessergestellt, da sie künftig in der Regel 55 Prozent der Unterhaltszahlungen behalten dürften. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, die heute den Kinderzuschlag bekommen, würden etwa 60 Euro mehr im Monat erhalten, junge Erwachsene voraussichtlich 42 Euro mehr. Kinder bis 14 Jahre könnten durch die Neuberechnung des soziokulturellen Existenzminimums bis zu 28 Euro monatlich mehr erhalten, sagte Paus.
Die Armutsquote für Kinder und Jugendliche liegt in Deutschland seit Jahren bei rund 20 Prozent. Insgesamt sollen mit der Kindergrundsicherung 5,6 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erreicht werden, davon knapp zwei Millionen Kinder, die heute Bürgergeld beziehen. Die Reform werde dafür sorgen, dass Familien ihre Leistungen schneller, besser und einfacher erhielten, versicherte Paus.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bezweifelte das. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel forderte die Fraktionen im Bundestag auf, das Gesetz zu verbessern. Viele Familien müssten für einzelne Unterstützungen, etwa für eine Klassenfahrt, andernfalls auch weiterhin zum Jobcenter. Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, rechnete hingegen vor, dass die 1.000 Jobcenter in Deutschland näher an den Menschen seien, als es 300 Familienservice-Stellen für die Kindergrundsicherung sein könnten. Es würden teure Doppelstrukturen aufgebaut: „Das wird ein Verwaltungs-Desaster“, warnte Sager. Ähnlich äußerte sich der Städte- und Gemeindebund. Er rechnet mit 500 Millionen Euro zusätzlicher Verwaltungskosten.
Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, begrüßte den Kabinettsbeschluss. Er kritisierte aber, dass der Gesetzentwurf noch nicht abschließend rechtlich geprüft sei und kündigte an, dass der Bundestag erst mit den Beratungen beginnen werde, wenn dies geschehen sei. Das Familienministerium rechnet für die zweite und die vierte Novemberwoche mit den ersten Beratungen im Bundestag und Bundesrat. Die Vize-Fraktionsvorsitzende der Union, Dorothee Bär (CSU) kritisierte, die Regierung schicke ein „unausgegorenes und umstrittenes Konzept“ ans Parlament und setze sich in beispielloser Weise über die Einwände von Ländern, Kommunen und Verbänden hinweg.
Mehr als 20 Verbände forderten, minderjährige Flüchtlinge in die Kindergrundsicherung einzubeziehen. In einem gemeinsamen Appell erklärten unter anderen die Diakonie, das Kinderhilfswerk, der Paritätische und Pro Asyl, die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen verbiete eine Diskriminierung aufgrund von Herkunft und Aufenthaltsstatus. Paus bestätigte, dass Kinder von Asylbewerberinnen und -bewerbern nicht einbezogen würden.
Für die Kindergrundsicherung stehen im Einführungsjahr 2,4 Milliarden Euro im Bundeshaushalt zur Verfügung, nach Angaben von Paus davon zunächst gut 400 Millionen für den Umbau der Verwaltung. Anfangs hatte die Ministerin zwölf Milliarden Euro für ihr Projekt gefordert. Im Gesetzentwurf wird davon ausgegangen, dass die Ausgaben für die Kindergrundsicherung bis 2028 bei einer Inanspruchnahme von 80 Prozent auf knapp sechs Milliarden Euro steigen werden.