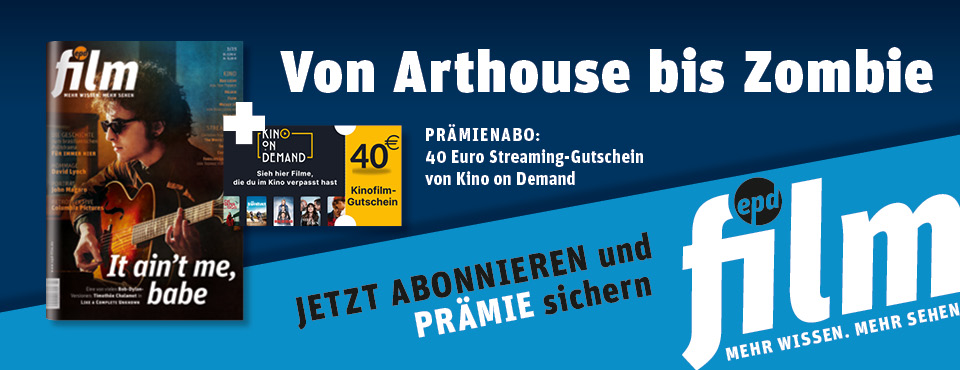Berlin (epd). Die Bundesländer scheuen sich vor einer Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen. Wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) unter den Landesregierungen der 14 Länder, die Staatsleistungen zahlen, ergab, hat die Ablösung für die überwiegende Mehrheit keine Priorität. Einige sehen das wegen der derzeit angespannten Haushaltslage dezidiert kritisch. Es sei ein schlechter Zeitpunkt, hieß es etwa aus Thüringen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.
Man sei grundsätzlich offen gegenüber diesem Vorhaben der Bundesregierung, zentrale Fragen müssten aber noch geklärt werden, erklärten wiederum Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Es sei noch „kein für alle Beteiligten konsensfähiges Ablöse-Modell bekannt“, sagte ein Sprecher des Brandenburger Kultusministeriums. Viele Länder verwiesen auf die in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossene Position, das Thema zunächst zurückzustellen.
Staatsleistungen erhalten die Kirchen als Entschädigung für die Enteignung kirchlicher Güter und Grundstücke im Zuge der Säkularisierung vor allem Anfang des 19. Jahrhunderts. Hamburg und Bremen zahlen keine Staatsleistungen. Das Grundgesetz enthält einen aus der Weimarer Reichsverfassung übernommenen Auftrag, diese Entschädigungszahlungen abzulösen. Möglich wäre dies etwa durch Einmal- oder Ratenzahlungen.
Die Ampel-Koalition will das Thema angehen. Ziel sei ein entsprechendes Grundsätzegesetz in dieser Wahlperiode, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums dem epd. Der Bund müsste die Rahmenbedingungen zur Ablösung gesetzlich regeln. Die Gespräche, die darüber Anfang des Jahres in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern von Bund, Ländern und Kirchen geführt wurden, liegen aber wegen des Widerstands der Länder derzeit auf Eis.
Die Länder, die zahlen müssten, verweisen wiederum auf die Notwendigkeit der Regelung durch den Bund. Eine Ausnahme ist Bayern: Vertragliche Ablösungen im Einvernehmen zwischen Staat und Kirchen seien unabhängig von einem Grundsätzegesetz möglich und würden in Bayern insbesondere auf dem Feld staatlicher Baupflichten an kirchlichen Gebäuden seit Jahren praktiziert, hieß es aus dem dortigen Kultusministerium. Ein Sonderfall unter den Ländern ist auch Sachsen, wo nach Angaben der Staatskanzlei in den Kirchenverträgen nach der Wiedervereinigung eine sogenannte Abgeltung in Form der jährlichen Leistungen festgeschrieben wurde. Das Weiterzahlen auf unbefristete Zeit wird dort bereits als Ablösung verstanden.
Wie die Rückmeldungen aus den Bundesländern ergaben, summieren sich die Staatsleistungen inzwischen auf mehr als 600 Millionen Euro pro Jahr. Rund 638 Millionen Euro zahlen die Länder in diesem Jahr, hauptsächlich an evangelische (rund 356 Millionen Euro) und katholische (rund 247 Millionen Euro) Kirche.
Die Höhe und damit die Bedeutung der Staatsleistungen für Kirchen- und Landeshaushalte variiert dabei stark. Baden-Württemberg zahlt mit 141 Millionen Euro die höchste Summe, Sachsen-Anhalt nach eigenen Angaben mit 42,1 Millionen Euro die höchsten Staatsleistungen pro Einwohner. In Bayern summieren sich die Staatsleistungen in diesem Jahr auf 130 Millionen Euro, in Rheinland-Pfalz auf 66,6 Millionen Euro, im Saarland auf eine knappe Million Euro.
Die Kirchen wiederum zeigen sich seit einiger Zeit durchaus offen für die Ablösung. Sie habe angesichts der Haushaltssituation Verständnis für die Zurückhaltung der Länder, für die eine Ablösung eine zusätzliche Belastung darstellen würde, sagte die Bevollmächtigte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anne Gidion, dem epd. Zugleich stehe man weiter „für eine Kooperation zur Einlösung des Verfassungsauftrags bereit“. Es gebe Ablösemodelle, deren Umsetzung sich kurzfristig nicht so stark auf die Haushalte der Länder auswirken würde, sondern langfristige Perspektiven schüfe, ergänzte sie.