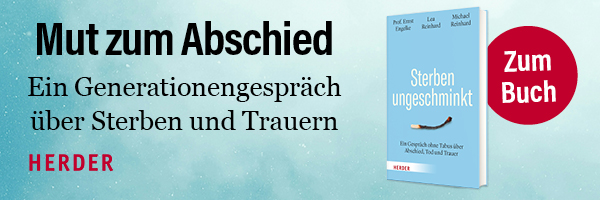Gütersloh (epd). In Deutschland erhalten Patienten einer aktuellen Studie zufolge zu oft unnötige Behandlungen und überflüssige Medikamente. So komme es etwa jährlich zu rund 70.000 Schilddrüsenoperationen, obwohl bei etwa 90 Prozent der Eingriffe keine bösartigen Veränderungen vorliegen würden, heißt es in einer am Dienstag in Gütersloh veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung.
Die Analysen im Auftrag der Stiftung lagen in den Händen des Berliner Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES) und des Kölner Marktforschungsinstituts Rheingold. Neben einer Literaturrecherche zu dem Thema wurden 24 Patienten und 15 Ärzte in ausführlichen Interviews befragt. Zudem nahm das Bielefelder Marktforschungsinstitut Kantar im September 2019 eine repräsentative Umfrage vor.
Mit einer besseren Diagnostik könnten viele dieser Eingriffe vermieden werden. Auch bei Eierstockoperationen liege lediglich bei zehn Prozent der operierten Frauen eine bösartige Erkrankung vor. Zu unnötigen Eingriffen komme es auch, weil vielen Frauen ohne Risiko ein Screening empfohlen werde, obwohl das gegen Leitlinien verstoße, kritisierte die Bertelsmann Stiftung.
Als Ursachen von medizinischer Überversorgung nennt die Studie Planungs-, Vergütungs- und Steuerungsdefizite im Gesundheitssystem. Klinikärzte stünden im Arbeitsalltag unter Druck, Unternehmensziele mit dem Patientenwohl in Einklang zu bringen.
Eine weitere Ursache für eine Überversorgung sind nach Einschätzung der Autoren der Studie auch die Erwartungen der Patienten. Zwar seien rund die Hälfte der befragten Bürger der Meinung, dass oft medizinisch nicht notwendige Leistungen erbracht würden. Viele Patienten forderten jedoch eher viele Leistungen ein und hielten diese für wichtig. Vor allem bei der Diagnostik fehle das Bewusstsein für mögliche Risiken durch falsch-positive Befunde oder unnötige Fehlbehandlungen, heißt in der Erhebung. 56 Prozent der Befragten hielten jede Therapie besser als Abwarten.
Im ambulanten Bereich beeinflussten individuelle Einkommens- oder Renditeziele die selbstständigen oder angestellten Ärzte in ihren Entscheidungen. Auch bei den Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL), die nicht von den Krankenkassen erstattet werden, deute vieles auf ein "zu viel" hin, hieß es. Jährlich würden rund 15 Millionen solcher Leistungen erbracht, für die Patienten rund eine Milliarde Euro zahlten.
Überflüssige und in ihrem Nutzen fragwürdige Untersuchungen, Operationen, Therapien und Arzneimittelverschreibungen würden den Patienten schaden, kritisierte die Stiftung. Sie könnten zu Verunsicherung, Komplikationen und unnötigen Folgeeingriffen führen. Außerdem würden sie medizinisches Personal binden, die für andere Behandlungen dringender benötigt würden, hieß es.
Die Studie mahnte mehr Transparenz bei Nutzen und Risiken medizinischer Leistungen an. Die Honorierung von Leistungen müsse sich zudem stärker an der Qualität orientieren. Patienten sollten für mögliche Risiken und Schäden von Behandlungen sensibilisiert werden. Ihnen müsse bewusstwerden, dass es besser sein könne, wenn eine medizinische Maßnahme unterlassen werden, schreiben die Autoren.