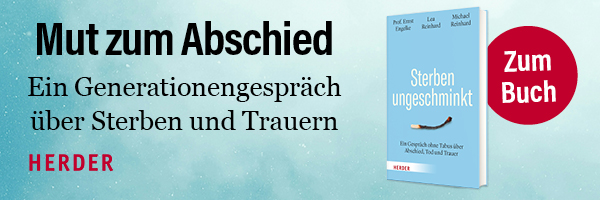Im "Easy Going" riecht es leicht süßlich, Rauchschwaden wabern durch die Luft. Die Warteschlangen vor den beiden Verkaufsluken ziehen sich fast bis zum Eingang. Ein Türsteher kontrolliert die Ausweise der Besucher und jagt sie durch einen Scanner. Viele wollen in den "Raucherbereich", durchsichtige Wände trennen ihn von den restlichen Räumen. Die Tische und Bänke dort sind aus Pressspan, hellbraun furniert, und am Boden festgeschraubt. Lange bleiben soll hier niemand. Marc Josemans, der Chef, sitzt im Stockwerk darüber in seinem Büro und tippt in seinen Computer. Zwei große Flachbildschirme zeigen ihm die Bilder seiner 46 Überwachungskameras. Er geht auf Nummer sicher, niemand sonst darf hier etwas verkaufen.
In seinem Büro überwacht Marc Josemans, was die Kunden in seinem Coffee-Shop tun. Foto: Philipp Alvares de Souza Soares
Josemans kifft seit er 16 ist. Schon 36 Jahre lang dauert seine Beziehung zur Droge - sie ist zu seinem Lebensinhalt geworden. "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht", sagt der 52 Jahre alte Niederländer. Josemans hat keine Ausbildung und arbeitete als Hilfskraft auf Jahrmärkten bis er vor 28 Jahren ins Cannabis-Geschäft einstieg und das "Easy Going" im Zentrum von Maastricht eröffnete. Es ist der älteste Coffee-Shop der Stadt. Die Droge habe ihn reich gemacht, sagt Josemans.
Er gestikuliert leidenschaftlich, mit festem Blick, wenn ihm ein Argument wichtig ist. Spontan würde man ihn nicht für einen Kiffer halten, er sieht gesund aus, seine Augen sind klar. Das macht Josemans zu einem idealen Repräsentanten für dieses Gewerbe. Daher verwundert es kaum, dass er einer der obersten Coffee-Shop-Lobbyisten der Niederlande ist: Er sitzt der Maastrichter Coffee-Shop-Vereinigung VOCM vor und ist Vorstandsmitglied des LOC, dem Pendant auf nationaler Ebene. Vergangenen Oktober trat er in einer drogenpolitischen Anhörung des niederländischen Parlaments als Experte auf.
Sie pinkeln auf die Straße, schmeißen ihren Müll auf den Bürgersteig,...
Auf die Politiker ist Josemans momentan allerdings nicht gut zu sprechen. Sie wollen ihm sein Geschäft verderben. "Nur weil es in Den Haag jetzt xenophobe Politiker gibt, muss ich noch lange nicht mitsingen", sagt er. Die Politiker wollen Nichteinwohner der Niederlande aus den Coffee-Shops verbannen. Die Kiffer aus dem Ausland benehmen sich angeblich schlecht: Sie pinkeln auf die Straße, schmeißen ihren Müll auf den Bürgersteig, schlafen im Auto und blockieren Parkplätze. Die grenznahe Lage der Stadt lockt jedes Jahr über zwei Millionen Menschen nach Maastricht, die nur die Coffee-Shops besuchen wollen. Einige Anwohner stört das, sie fühlen sich in der Innenstadt nicht mehr sicher.
Der Kunststudent Stephen Bell hält das für übertriebenes Gerede: "Die meisten kaufen nur ihre vier oder fünf Gramm und fahren heim. Nur weil es ein paar Idioten gibt, die dann auf die Straße pissen, muss man nicht diesen bürokratischen Unsinn machen", sagt er. Bell sitzt zusammen mit seinem Münchner Kommilitonen Bruno Grokenberger auf der Terrasse des Coffee-Shops "Heaven 69". Die beiden nippen abwechselnd an den Strohhalmen ihrer Orangina-Fläschchen.
Kiffen wollen sie heute nicht - zu viel zu tun. Beide kennen die Reaktion ihres Körpers auf die Droge genau. Wenn Grokenberger lernen muss, raucht er nicht mehr nach acht Uhr, um am nächsten Tag wieder fit zu sein, wie er sagt. Ihm gefällt es in Maastricht: In München musste er einen Dealer aufsuchen, hier kann er sich sein Gras legal besorgen. Der Dealer wollte ihm auch anderes Zeug andrehen, doch Grokenberger mag nur Cannabis. Vom Ausländerverbot halten die beiden Studenten nur wenig. Die konservativen Leute in Maastricht würden einfach keinen Wandel mögen, analysiert der Niederländer Bell die aktuelle Diskussion. Bell mag keine Konservativen. Auch Studenten würden viele hier nicht gerne sehen - zu viel Party, Alkohol, Lärm. Seinen Master will er in Amsterdam machen, da sei man toleranter.
Legaler und illegaler Drogenmarkt sind miteinander verbunden
Aber Vandalismus und schlechtes Benehmen sind nicht die einzigen Probleme, die man in Maastricht mit dem Ausländerverbot lösen will: Sogenannte "drugs runners" fangen hier Drogentouristen an den Parkplätzen ab und führen sie zu ihren Chefs, den Dealern, die mehr als Gras im Angebot haben. Dabei sind sie nicht zimperlich, schließlich gibt es eine Prämie für jeden abgeworbenen Kunden. Hinzu kommen die Geschäftemacher, die hinter der Cannabisproduktion stecken. Diese operieren noch immer illegal. Der Großhandel und die Produktion der Droge sind verboten, obwohl es ohne diese Produktionskette auch keine legalen Coffee-Shops gäbe.
Die Popularität der Cannabis-Läden, gerade auch bei Besuchern aus dem Ausland, hat diese Schattenindustrie stetig wachsen lassen. Coffee-Shop-Besitzer Marc Josemans fragt: Würde das sogenannte "Einwohnerkriterium" der Politiker die Kriminalität nicht nur befördern? Die ausländischen Gäste würden einfach direkt zu den Straßendealern gehen. Sowieso würden sich alle Probleme lösen, wenn die Regierung endlich auch die "Hintertür" der Coffee-Shops legalisierte, meint Josemans. Also auch Produktion und Großhandel. Allein die Steuern, die der Staat zusätzlich einnehmen und die Polizeikosten die er sparen würde - für Josemans bleibt da keine Frage offen. Die Coffee-Shops allein bringen den Niederlanden geschätzt jährliche Steuereinnahmen von 450 Millionen Euro.
Marc Josemans und seine Mitstreiter im VOCM wehren sich seit über fünf Jahren gegen den Ausschluss ihrer ausländischen Kundschaft. Die Idee ist Teil des Koalitionsvertrags zwischen den beiden Regierungsparteien des Landes. Josemans hat 2006 zusammen mit dem damaligen Bürgermeister ein Gerichtsverfahren provoziert, um vorbeugend eine juristische Entscheidung zu erzwingen. Bis vor den Europäischen Gerichtshof ist er gezogen. Dieser urteilte jedoch im Dezember 2010, dass eine lokale Diskriminierung zur Verminderung des Drogentourismus zulässig sei. Ein holländisches Gericht bestätigte die Entscheidung im vergangenen Sommer.
"Nur bestimmte Ausländer auszuschließen ist doch erst recht diskriminierend"
Josemans VOCM ist im vergangenen Herbst mit einem eigenen Modell vorgeprescht, um vor Gericht besser dazustehen: Nur Einwohner der Niederlande, Belgiens und Deutschlands dürfen seit dem 1. Oktober in Maastricht Cannabis kaufen - Belgier und Deutsche sind die größten ausländischen Kundengruppen. Außerdem hat man der Forderung der Gemeinde zugestimmt, sieben der vierzehn Shops aus dem Zentrum in die Außenbezirke zu verlegen. Josemans meint, den Politikern damit schon relativ weit entgegengekommen zu sein. "Wir machen seitdem 20 Prozent weniger Umsatz", sagt er. Doch verbessert habe sich nichts – im Gegenteil: Er habe neun Briefe von Anwohnerorganisationen bekommen, die sich über mehr Straßenkriminalität beschweren, sagt Josemans.
Petro Hermans berät den Bürgermeister von Maastricht in Fragen der Drogenpolitik. Foto: Philipp Alvares de Souza Soares
Die Gemeinde beharrte jedoch weiterhin darauf, den Wohnsitz in den Niederlanden entscheiden zu lassen. Sie sieht darin eine Rückkehr zum ursprünglichen Ziel der niederländischen Duldungspolitik: Eine Trennung des Marktes von harten und weichen Drogen. Durch die Entkriminalisierung des Geschäfts mit Cannabisprodukten sollen deren Konsumenten nicht in Kontakt mit gefährlicheren, harten Substanzen wie Kokain und Heroin kommen. Der Coffee-Shop-Tourismus hat diese liberale Drogenpolitik jedoch an ihre Grenze geführt. Einerseits wird so das Geschäft der "drugs runners" überhaupt erst ermöglicht, andererseits ist es nicht das Ziel, auch das Ausland mitzuversorgen.
"Wir wollen zu unseren Ursprüngen zurück", sagt Petro Hermans, der den Bürgermeister Maastrichts in Sachen Drogen berät. Die Stadt müsse einfach etwas unternehmen, um den Markt wieder einzudämmen. Die Bürger Maastrichts seien die Kifferscharen aus Deutschland und Belgien leid, sie wollen ihre Ruhe haben. Hermans ist ein besonnener Mann. Er spricht gut Deutsch und erklärt die Dinge ausführlich, kernige Floskeln sind nicht sein Ding. Schon 13 Jahre beschäftigt er sich mit Drogenpolitik. Er will versöhnen. Von Josemans' Vorschlag hält Hermans wenig: "Nur bestimmte Ausländer auszuschließen ist doch erst recht diskriminierend", meint er.
Lösungsvorschlag: eine gemeinsame Basis für die ganze EU
Zum 1. Mai soll das Einwohnerkriterium nun schrittweise eingeführt. In den südlichen Grenzprovinzen Zeeland, Nord-Brabant und Limburg wird es dann verboten sein, Gäste, die nicht ihren Wohnsitz in den Niederlanden haben, zu bedienen. Im Rest des Landes werden sie noch bis Ende des Jahres geduldet. Praktisch werden die Coffee-Shops zu Clubs, die Mitgliedsausweise ausgeben. Für maximal 2000 Personen pro Shop.
Für Josemans ist der Kampf dennoch nicht vorbei. Er und seine Maastrichter Kollegen wollen ab 1. Mai einfach weiterhin an Ausländer verkaufen. "An jeden über 18." Gegen die dann verhängte Strafe – einen Monat den Laden zu schließen – würde er dann wieder vor Gericht ziehen. Bis zur letzten Instanz. Alles soll also bleiben, wie es ist. "Ich weigere mich zu diskriminieren", nennt Josemans das etwas pathetisch.
Die beste Lösung, sagt Berater Hermans noch, stehe leider gar nicht zur Debatte. Die vielen Coffee-Shop-Touristen seien der beste Beweis für den Erfolg der niederländischen Duldungspolitik: Die Menschen versorgen sich lieber in einem Geschäft als bei einem Straßendealer. War in Deutschland nicht vor einiger Zeit von toten Kiffern zu lesen, die Blei im Gras hatten? Hermans ist sich sicher: Würden die Nachbarländer oder am besten gleich die ganze EU auf dieser Basis eine gemeinsame Lösung suchen, würden sich Maastrichts Probleme in Luft auflösen.