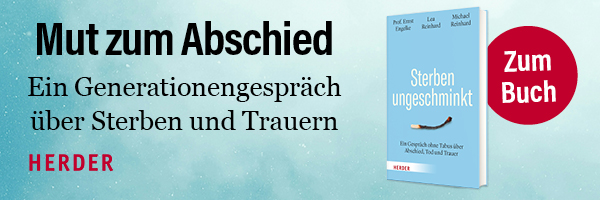Wann wird im Sport aus einem schweren Gegner ein Angstgegner?
Jeannine Ohlert: Das hat nicht nur mit den letzten Spielergebnissen zu tun, es steckt viel mehr dahinter. Ein Gegner wird in dem Moment zum Angstgegner, wenn sich zum Beispiel Fußballer vor dem Spiel Gedanken machen: Oh Gott, das könnte jetzt in die Hose gehen. Das hat zwar etwas damit zu tun, wie vergangene Spiele gelaufen sind. Es kann aber auch sein, dass die Mannschaft das letzte Spiel gewonnen hat, der Gegner aber ein Angstgegner bleibt, weil man weiß, dass man beim letzten Mal einfach nur Glück hatte.
###mehr-info###
Fallen Ihnen Beispiele für Angstgegner im Sport ein außer Deutschland – Italien?
Ohlert: In der Fußballbundesliga ist Köln gegen Kaiserslautern so ein Fall. Köln war zwar meistens auf dem Papier der bessere Verein, hat sich aber gegen Kaiserslautern immer schwer getan. Und klar, für die Deutsche Nationalmannschaft ist das Spiel gegen Italien schwierig.
Die Spieler kriegen von der Presse die Statistiken der letzten Spiele unter die Nase gehalten und das kann bei dem einen oder anderen dazu führen, dass er denkt: Da scheinen wir ein Problem zu haben. Und das, obwohl das häufig keine persönliche Bilanz ist, wie bei einem Tennisspieler, sondern eine Bilanz der Mannschaft. Heute haben wir eine andere Spielergeneration und andere Aufstellungen – es kann alles ganz anders aussehen.
Also vererbt sich die Angst vor einem Gegner von einer Spielergeneration auf die nächste?
Ohlert: Sie kann sich insofern vererben, als in einer Mannschaft immer noch einige Spieler sind, die die letzte oder vorletzte Niederlage mitbekommen haben. Viel wird auch durch die Medien transportiert. Es kommt dann darauf an, wie sehr die Spieler solche Berichte an sich heran lassen. Der englische Torwart hat vor dem Elfmeterschießen gegen Italien gesagt, er hätte keine Angst – obwohl es hieß, die Engländer verlieren immer im Elfmeterschießen. Der Torwart hat aber gesagt: Nein, das ist nicht meine persönliche Statistik. Das ist die Art, wie man am besten damit umgeht.
Kann denn die Angst vor einem bestimmten Gegner den Spielverlauf beeinflussen?
Ohlert: Angst kann sich positiv und negativ auswirken. Positiv, weil ich in solchen Spielen wachsamer bin und den Gegner ernst nehme. Egal ob er wie Italien vorher nicht wirklich geglänzt hat, sodass man eigentlich weniger Angst vor ihm haben müsste. Aber da denken die Spieler dann vielleicht: Die Italiener waren zwar bisher nicht so gut, aber die Deutschen haben sich gegen sie immer schwer getan, also: Achtung. Das hat dann nicht so viel mit Angst zu tun, sondern bedeutet eher eine Herausforderung.
Jeannine Ohlert ist Sportpsychologin an der Sporthochschule Köln. Foto: privat.
Problematisch wird es, wenn ein Spieler so nervös wird, dass seine Muskeln zumachen, weil aus Angst die Muskelspannung allgemein steigt. Das führt dazu, dass gerade kleine und schnelle Bewegungen, wo Koordination gefragt ist, etwas abgehackt und nicht mehr so rund sind. Es kann natürlich auch sein, dass der Spieler Magenprobleme bekommt oder ihm vor dem Spiel schlecht ist. Angst ist körperlich spürbar.
Sie hat aber auch eine zweite Komponente: Das, was im Kopf passiert. Ich fange an, mir Sorgen zu machen und denke an Fehler, die ich früher gemacht habe oder an die Konsequenzen, wenn meine Mannschaft verliert. Ich beschäftige mich also nicht mit dem Hier und Jetzt, was sinnvoll wäre, sondern lasse meine Gedanken wandern. Dadurch bekomme ich noch mehr Angst. Das ist ein Teufelskreis und kann zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden – man verliert wirklich.
Haben Sie Tipps, wie man diesen Teufelskreis durchbrechen kann?
Ohlert: Psychologen versuchen, immer da anzusetzen, wo sich die Angst bei dem einzelnen Spieler auswirkt – eher im Körper oder eher im Kopf. Allerdings nützt es wenig, wenn sie das erst kurz vor dem Spiel tun. Einem Spieler zu sagen: "Denk da nicht dran", funktioniert nicht. Idealerweise lernen Profisportler schon im Laufe der Jahre, wie sie mit Angst umgehen können. Es gibt Strategien, die man aber über längere Zeit einüben muss.
###mehr-artikel###
Man versucht zum Beispiel, den Sorgen positive Bilder entgegenzusetzen. Wenn ein Torhüter Angst hat, dass er bei einer Ecke am Ball vorbeigreift, wird vorher trainiert, sich diese Situation immer wieder vorzustellen, aber positiv – wie er den Ball hält. Denn der Torwart hat ja positive Erinnerungen von anderen Spielen. Solche Übungen verschaffen dem Spieler mehr Selbstbewusstsein und erinnern seinen Körper daran, wie es geht. Denn die Erinnerungen haben tatsächlich einen körperlichen Effekt. Der dritte Vorteil ist, dass die Angst verschwindet, weil der Spieler sich erinnert: Ach ja, ich kann’s ja.
Und was kann man gegen die körperlichen Auswirkungen von Angst machen?
Ohlert: Dafür kann man Entspannungsmethoden einsetzen. Die sollte man ebenfalls über einen längeren Zeitraum einüben. Genauso, wie beim Fußball ein neuer Trick nicht beim ersten Mal funktioniert, klappt auch eine neue Mentalstrategie beim ersten Mal meistens nicht. Man kann lernen, auf dem Weg der progressiven Muskelentspannung gezielt bestimmte Muskelgruppen zu lockern. So kann ein Sportler zum Beispiel speziell seine Beine entspannen. Es gibt auch andere Entspannungsmethoden wie Atemtechniken, die man direkt vor dem Spiel in der Kabine einsetzen kann.
Für die deutsche Mannschaft ist es jetzt aber zu spät, sich solche Strategien noch vor dem Halbfinale gegen Italien anzutrainieren?
Ohlert: Die Spieler, die in der Nationalmannschaft spielen, können das eigentlich schon. Sonst wären sie nicht so weit gekommen. Der Hauptunterschied zwischen einem Drittliga-Fußballer und einem Nationalspieler ist vielleicht zu zehn Prozent die Technik, aber aus meiner Sicht zu 90 Prozent, dass die Nationalspieler es schaffen, mit dem Druck umzugehen. Vor 50.000 Menschen im Stadion zu spielen und zu wissen, es guckt die ganze Nation zu und alle regen sich auf, wenn ich den Ball am Tor vorbei schieße – das kann einfach nicht jeder. Dennoch hat die Nationalmannschaft immer einen Sportpsychologen dabei, der bei akuten Schwierigkeiten noch versuchen kann zu helfen.