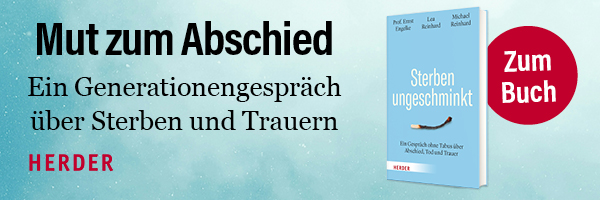Berlin (epd). Die Kenntnisse der Menschen in Deutschland über den Nationalsozialismus weisen teilweise große Lücken auf. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung zum kritischen Geschichtsbewusstsein und der Erinnerungskultur in Deutschland, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.
Zudem befürwortet zum ersten Mal seit 2018 in der regelmäßig erscheinenden Studie eine knappe Mehrheit der Befragten (38,1 Prozent), einen „Schlussstrich“ unter die NS-Zeit zu ziehen; 37,2 Prozent lehnten einen „Schlussstrich“ dagegen ab. Der „Schlussstrich“-Aussage stimmten laut Studie am ehesten Menschen im mittleren Altersbereich sowie AfD-Wähler zu. Jüngere und Ältere, sowie Menschen mit höherem Bildungsabschluss, lehnten die Aussage eher ab.
Die sogenannte „Gedenkanstoß-Memo-Studie“ beruht auf einer Online-Befragung im Oktober 2024 von 3.000 Menschen ab 18 Jahren mit dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland. Über die Hälfte der Befragten gab an, wenig oder überhaupt nichts über die NS-Geschichte am eigenen Wohnort zu wissen. „Strukturelles Wissen über NS-Verbrechen ist vorhanden. Aber je konkreter es wird, desto geringer wird das Wissen“, sagte Veronika Hager von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ), die die Studie beauftragt hat.
Nur etwa ein Drittel (35,5 Prozent) der Befragten habe grob erklären können, was im Kontext der NS-Zeit unter dem Begriff „Euthanasie“, also der gezielten Ermordung Kranker, zu verstehen sei. Etwa drei Viertel der Befragten konnten keine realistischen Einschätzungen zu Opferzahlen geben. Dies betraf auch die Anzahl der ermordeten Sinti und Roma oder die Zahl der eingesetzten Zwangsarbeiter.
Gleichzeitig könne man an dem mangelnden Wissen ansetzen, etwas zu ändern, sagte Hager. Positiv stimme sie, dass fast 40 Prozent der Befragten angeben, sie könnten etwas für die Erinnerungsarbeit tun. Dem gegenüber gaben nur acht Prozent an, sich bereits dafür zu engagieren. Der Leiter der Studie, Jonas Rees, sagte: „Was mir Hoffnung macht, sind die Interessierten.“ Es könnten noch viele für die Gedenkarbeit gewonnen werden.
Zudem sei mehr als 40 Prozent der Befragten wichtig, die Erinnerungen an die NS-Verbrechen lebendig zu halten. Weniger als einem Viertel sei dies nicht wichtig. Positiv sei auch, so die Studienautoren, dass fast drei Viertel der Teilnehmer (72,1 Prozent) angaben, schon mindestens einmal eine Gedenkstätte oder einen Gedenkort zur Erinnerung an NS-Unrecht besucht zu haben.
Damit blieben KZ-Gedenkstätten weiterhin die zentralen Lernorte, sagte Andrea Riedle, Direktorin der Stiftung Topographie des Terrors. „Die jungen Leute merken, dass sie wenig wissen. Und kommen deswegen her.“ Mittlerweile kämen in das Dokumentationszentrum drei Viertel der Besucher aus dem Ausland. Sie betonte, es sei „wichtig, dass solche Orte eintrittsfrei und für jeden zugänglich bleiben“.