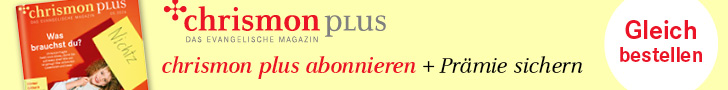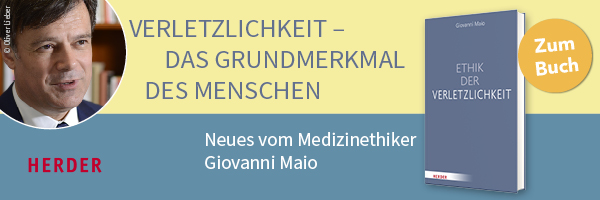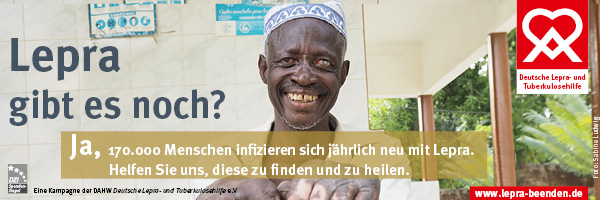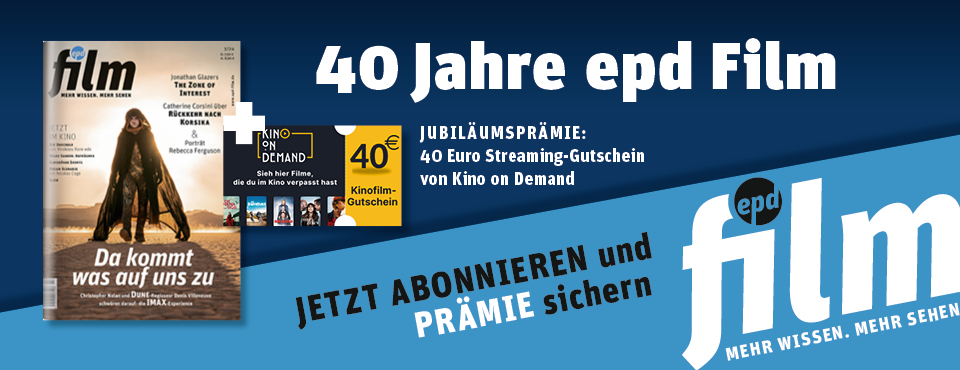Gütersloh, Berlin (epd). Nach der Corona-Masseninfektion in einem Schlachtbetrieb im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück fordern Politiker und Gewerkschaften schärfere Arbeitsegelungen in der Fleischindustrie. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte an, mit Hochdruck das Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft umzusetzen. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) forderte eine Haftungspflicht von Schlachthofbesitzern gegenüber Werkvertragsarbeitern. Die Gewerkschaft ver.di kritisierte, dass in Fleischbetrieben Abstandsgebote nicht eingehalten würden.
Heil sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (Donnerstag), bei der Umsetzung des Arbeitsschutzprogramms in der Fleischwirtschaft werde er sich von lauten Lobbyinteressen nicht bremsen lassen: "Wir werden hier aufräumen und für menschenwürdige Arbeitsbedingungen sorgen." Es werde mit Hochdruck an der Umsetzung des im Mai beschlossenen Arbeitsschutzprogramms gearbeitet. Dazu gehörten verpflichtende Kontrollen der Arbeitsschutzbehörden der Länder, die digitale Arbeitszeiterfassung und die rechtsfeste Untersagung von Werkverträgen.
NRW-Arbeitsministerin Laumann forderte im WDR-Radio "eine klare restriktive Gesetzesüberarbeitung". Jeder Besitzer eines Schlachthofs müsse auch für die Werkvertragsarbeiter und ausländische Beschäftigte haften. Ver.di kritisierte unzureichende Hygienepläne. Die Gewerkschaft Nahrungs-Genuss-Gaststätten (NGG) forderte ein umgehendes Verbot von Werkverträgen. Auch der Sozialverband VdK macht sich für ein Ende von Leiharbeit und Werkverträgen stark. Sie ermöglichten es den Fleischkonzernen, Mitarbeiter zu rumänischen Mindestlöhnen und Sozialstandards zu beschäftigen.
Heftige Kritik lösten Vermutungen aus, osteuropäische Arbeiter könnten nach ihren Heimfahrten das Coronavirus in den Betrieb gebracht haben. Die westfälische Präses Annette Kurschus warnte, einseitige und voreilige Schuldzuweisungen schürten Ressentiments und gefährdeten den gesellschaftlichen Zusammenhalt. "Ich bitte die politisch Verantwortlichen um Sorgfalt und Besonnenheit bei der Suche nach den Ursachen", sagte die leitende Theologin der Evangelischen Kirche von Westfalen.
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Mittwoch auf die Frage, was die aktuellen Coronafälle über die Lockerungen in NRW aussagten, geantwortet: "Das sagt überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt." Das werde überall passieren, weil es in ganz Deutschland ähnliche Regelungen gebe, fügte Laschet hinzu und verwies unter anderem auf den Fall eines Corona-Ausbruchs in einem Spargelhof in Bayern: "Das hat nichts mit Lockerungen zu tun, sondern mit der Unterbringung von Menschen in Unterkünften und Arbeitsbedingungen in Betrieben."
Zuvor hatten der Sprecher von Tönnies, André Vielstädte, sowie der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer (CDU), die Vermutung geäußert, dass die Fälle möglicherweise auf die nun wieder möglichen Familienbesuche von Mitarbeitern zurückzuführen seien.
Der SPD-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag, Thomas Kutschaty, forderte Laschet und Tönnies auf, sich zu entschuldigen. "Die Behauptung von Clemens Tönnies und Armin Laschet, der Ausbruch sei auf Bulgaren und Rumänen zurückzuführen, ist infam und verwerflich", sagte Kutschaty dem Evangelischen Pressedienst (epd). Verantwortlich für den Corona-Ausbruch seien die Arbeits- und Lebensbedingungen in der Fleischindustrie, nicht die Herkunft der Erkrankten.
Der Kreis Gütersloh hatte die Anlieferung an das Tönnies-Betriebsgelände am Mittwoch gestoppt. Das dort gelagerte Fleisch wird aber noch verarbeitet und an Supermärkte ausgeliefert. Die Schließung könne bis zu zwei Wochen dauern, hieß es. Bis Mittwochabend war bei mehr als 650 Mitarbeitern des Schlachthofs in Rheda-Wiedenbrück eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden.