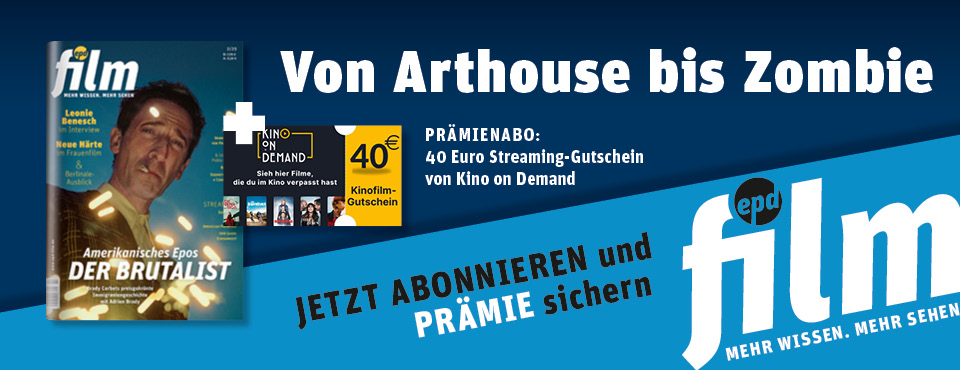Beim Thema Bibelübersetzung begegnet man oft der Meinung, eine Übersetzung sei umso gelungener, je wörtlicher sie ist. Dahinter steht das Anliegen, durch die Übersetzung dem Originaltext des Gotteswortes so nahe wie möglich zu kommen.
1. Die wortwörtliche (Wort-für-Wort) Übersetzung
Tatsächlich ist eine wortwörtliche Übersetzung zum Lesen der Bibel aber nur sehr bedingt geeignet. Denn dabei wird lediglich für jedes Wort der Originalsprache das entsprechende Wort in der entsprechenden grammatischen Form der Zielsprache eingesetzt. Es entsteht ein grammatisch nicht korrekter und weithin unverständlicher Text. Verwendung findet eine solche Übersetzung nur als Unterzeile unter dem hebräischen bzw. griechischen Text in einer sogenannten Interlinearversion (interlinear = zwischen den entsprechenden Zeilen des Textes in der Originalsprache). Sie dient dann als Brücke zum Originaltext für Leserinnen und Leser, die Hebräisch und Griechisch nicht oder nicht ausreichend beherrschen.
###mehr-artikel###
2. Die philologische Übersetzung
Was landläufig als „wörtliche“ Übersetzung bezeichnet wird, ist denn auch nicht eine solche wortwörtliche Übersetzung, sondern eine, die einen korrekten und verständlichen Text in der Zielsprache herstellt. Dies geschieht mit Hilfe von drei Verfahren:
- Die Wortfolge wird dem Gebrauch der Zielsprache angepasst.
- Grammatische und syntaktische Konstruktionen, die in der Zielsprache nicht gebräuchlich sind, werden durch darin übliche Konstruktionen ersetzt. Dies betrifft z.B. die griechischen Infinitivsätze wie am Anfang von Markus 1,14. Versucht man diese Konstruktion im Deutschen nachzuahmen, ergibt sich etwas wie: „Nachdem den Johannes Gefangen-genommen-habend-Sein“, grammatisch korrekt wird daraus: Nachdem Johannes gefangen genommen worden war.
-
Für ein und dasselbe Wort der Ausgangssprache wird je nach Zusammenhang das passende
Wort der Zielsprache gewählt. Das griechische xenos, das sowohl „Fremder“ als auch „Gastfreund“ oder „Gast“ bedeutet, wird entsprechend von der Lutherbibel in Matthäus 25,35 mit „Fremder“ übersetzt, in Römer 16,23 mit „Gastgeber“ und in Hebräer 11,13 mit „Gast“.
Eine Übersetzung, die so verfährt, wird „philologische Übersetzung“ genannt. Soweit es Ausgangs- und Zielsprache jeweils zulassen, besteht eine gewisse formale Entsprechung zwischen beiden. Als Faustregel dafür, wie weit diese Übereinstimmung gehen kann, gilt der berühmte Leitsatz aus dem schulischen Fremdsprachenunterricht: „So wörtlich wie möglich und so frei wie nötig.“ Was in diesem Zusammenhang jeweils „möglich“ und „nötig“ ist, liegt in der Entscheidung der Übersetzenden.
3. Die konkordante Übersetzung
Eine Sonderform der philologischen ist die so genannte konkordante Übersetzung (von Konkordanz = Übereinstimmung). Davon ist auch der Begriff der „Wortkonkordanz“ abgeleitet, das ist ein Nachschlagewerk, das die Suche nach biblischen Begriffen ermöglicht. Hier wird ein Begriff der Ausgangssprache immer mit demselben Begriff in der Zielsprache wiedergegeben. Das bedeutet allerdings, dass die Bedeutungsfülle, die ein Wort in einer Sprache haben kann (wie es z.B. beim oben zitierten xenos der Fall ist), in der Übersetzung nicht mehr zum Ausdruck kommt. Andererseits zeigen sich auf diese Weise mitunter Beziehungen zwischen biblischen Texten, die anders nicht zu erkennen sind.
Prinzipiell kann man sagen, dass philologische Übersetzungen von ihren Lesern und Leserinnen immer eine gewisse Anstrengung bei der Aneignung erfordern. Wenn ein Text in der Originalsprache anspruchsvoll ist, wird er es auch in einer philologischen Übersetzung bleiben.
4. Die kommunikative Übersetzung
In einer zunehmend säkularen Gesellschaft bringen immer weniger Menschen die Voraussetzungen mit, die zum Verstehen der Bibel nötig sind. Diese Beobachtung stand am Anfang der heute so genannten kommunikativen Übersetzungen. Ihnen geht es vor allem darum, dass ihre Leserinnen und Leser den Text auf Anhieb verstehen, er also unmittelbar mit ihnen kommuniziert.
Eine kommunikative Übersetzung verzichtet darauf, die sprachliche Form des Originaltextes nachzubilden. Im Vordergrund steht vielmehr die inhaltliche Übereinstimmung, also der Sinn des Originaltextes. Dieser wird durch die Exegese des Textes sorgfältig herausgearbeitet und dann in der Zielsprache entsprechend zum Ausdruck gebracht.
Wieder sind es v.a. drei sprachliche Verfahren, die von einer kommunikativen Übersetzung angewendet werden:
- Orientierung am Kontext: Für ein ausgangssprachliches Wort wird in der Zielsprache derjenige Begriff gewählt, der das Gemeinte im Zusammenhang am treffendsten wiedergibt. Zum Beispiel sind für das griechische Wort dynamis im Wörterbuch als deutsche Äquivalente die folgenden Oberbegriffe angegeben: Vermögen, Kraft: (physisch) Kraft, Stärke, Gewalt; (geistig) Fähigkeit; (übertragen) Macht, Einfluss. Zu jedem Oberbegriff gibt es dann wiederum eine Reihe von Unterpunkten, z.B. zur physischen Kraft die Punkte (a) Körperkraft, Lebenskraft; (b) Kriegsmacht, Streitkräfte; (c) Machtbereich, Reich; (d) Hilfsmittel, -quellen, Güterbesitz usw. Man ahnt, wie vielfältig ein griechisches Wort im Deutschen je nach Kontext wiedergegeben werden kann.
- Umstrukturierung: Längere Zusammenhänge, die – wie etwa das Vorwort des Lukasevangeliums – im Ausgangstext in kompliziert verschachtelten Sätzen formuliert sind, werden in der Zielsprache völlig neu aufgebaut, sodass die im Original gegebenen Informationen leichter aufgefasst werden können.
- Explikation: Informationen, die die Originalleserschaft dem ursprünglichen Text ganz selbstverständlich entnommen hat (z.B. dass die Dächer der Häuser in den Ländern der Bibel Flachdächer waren, auf denen große Teile des Alltagslebens stattfanden), die aber der Leserschaft unserer Zeit nicht mehr vertraut sind, werden in der Übersetzung ausdrücklich sichtbar gemacht.
Während bei der philologischen Übersetzung der Leser oder die Leserin zuletzt die Verantwortung dafür trägt, dass er oder sie einen Text richtig verstanden hat, wird diese Verantwortung von der kommunikativen Übersetzung selbst übernommen. Das hat allerdings eine unvermeidliche Konsequenz: Dort, wo eine philologische Übersetzung die Bedeutungsfülle eines biblischen Textes erkennen lässt, wird diese bei der kommunikativen Übersetzung auf eine Hauptbedeutung reduziert.
Es gibt für die kommunikative Übersetzung jedoch eine Grenze, die sie nicht überschreiten darf, solange sie eine Übersetzung bleiben will. Auf Nachfrage muss sie in der Lage sein, den Übersetzungsprozess sozusagen wieder rückwärts zu gehen und zu zeigen, an welchem Wort oder welcher Form des Ausgangstextes sie sich jeweils festmacht. Wenn eine Übersetzung über den Ausgangstext hinausgeht, also die Information des Textes erweitert und etwas sagt, was dieser nicht wenigstens implizit enthält, wird sie zur Nacherzählung, zur Paraphrase. Dies ist ein durchaus legitimes Verfahren. Streng genommen, ist jede Predigt ein Stück weit Paraphrase – es darf eben nur nicht der Eindruck erweckt werden, es handle sich um eine Übersetzung.
Fazit:
Prinzipiell muss man also feststellen, dass jede Übersetzung für das, was sie tut, ihren Preis zu zahlen hat. Generell kann man sagen: Je wörtlicher eine Übersetzung ist und je mehr sie die Bedeutungsfülle des Originals bewahrt, desto weniger verständlich ist sie auch. Je verständlicher eine Übersetzung ist, desto weniger lässt sie noch die Form des Originals erkennen und desto größer wird die Gefahr, dessen Botschaft zu verkürzen. Für das Bibelstudium empfiehlt es sich deshalb immer, mehrere Übersetzungen zur Hand zu nehmen, die sich dann gegenseitig ergänzen.