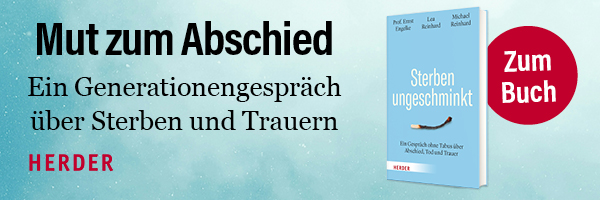Die inhaltliche und sachliche Genauigkeit hat für sie zwar erklärtermaßen Vorrang vor der formalen Übereinstimmung mit dem Grundtext, aber durch ihren ausführlichen Anmerkungsteil und die Kennzeichnung der Zufügungen zum Text stellt sie immer auch wieder die Verbindung zur Form des Grundtextes her. Dadurch eignet sie sich besonders für Menschen, die gerne mit verschiedenen Bibelübersetzungen arbeiten und ohne Kenntnis der biblischen Originalsprachen nachvollziehen wollen, wie es jeweils zu den unterschiedlichen Übersetzungen kommt.
Die Geschichte der NGÜ
Die Anfänge der Neuen Genfer Übersetzung sind eng mit der Schlachter-Bibel verbunden. Ihrem Übersetzer, dem Schweizer Pfarrer Franz Eugen Schlachter (1859 – 1911) war es darum gegangen, zu seiner Zeit eine verlässliche Bibelübersetzung in gut verständlichem Deutsch zu schaffen, da damals die Lutherbibel und die Zürcher Bibel noch kaum revidiert und entsprechend sprachlich altertümlich waren. Die erste Ausgabe der Schlachterbibel erschien 1905. Nach zwei Revisionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es Anfang der 80er Jahre dann Überlegungen zu einer Neurevision, die v.a. auch veraltete und heute z.T. nicht mehr verständliche Begriffe wie „Dirne“ oder „Farren“ durch zeitgemäßere ersetzten sollte. Die Diskussion darüber, wie „modern“ eine Revision der Schlachter Bibel werden könnte, stand an der Wiege der Neuen Genfer Übersetzung. Da der Spielraum bei der Schlachterbibel begrenzt war, wenn man den bestehenden Text so weit wie möglich bewahren wollte, entschloss man sich, neben der Revision ein neues Übersetzungsprojekt zu beginnen, das alle Anforderungen einer modernen Übersetzung erfüllte und im Unterschied zu Schlachter von den Grundtexten ausgeht, wie sie die moderne Textkritik rekonstruiert hat.
Zunächst wurden Ende der 80er Jahre die synoptischen Evangelien in kleinen Einzelheften publiziert. Danach folgten einzelne Briefe – ebenfalls als Einzelausgaben, bis 2000 und 2003 jeweils die vorhandenen Schriften zu einem Gesamtband vereinigt wurden. Im Jahr 2009 kam dann das Neue Testament heraus. Für 2011 ist die Veröffentlichung der Psalmen vorgesehen.
###mehr-artikel###
Das Übersetzungsverfahren und die Sprache der Neuen Genfer Übersetzung
Die Neue Genfer Übersetzung versteht sich als kommunikative Bibelübersetzung, die in der Tradition Schlachters versucht, höchste Texttreue mit größtmöglicher Verständlichkeit zu verbinden. Dieses Ziel wird zum einen dadurch erreicht, dass verdeutlichende Beifügungen zum Originaltext zwischen Akzentzeichen gesetzt und dadurch auf den ersten Blick zu erkennen sind. Zum anderen gibt es ausführliche Anmerkungen zur Übersetzung, die in der Randspalte platziert sind und die Brücke zum Originaltext schlagen. In diesen Anmerkungen findet man
- die wörtliche, d.h. formal genauere Wiedergabe eines Verses oder Versteils, wenn der Haupttext zugunsten der Verständlichkeit oder der inhaltlichen und sachlichen Genauigkeit in stärkerem Maß umformuliert ist,
- Alternative Übersetzungsmöglichkeiten,
- Hinweise auf andere Lesarten in den griechischen Handschriften des Neuen Testaments und die Übersetzungsvarianten, die sich daraus ergeben.
Die Neue Genfer Übersetzung verwendet eine natürliche und zeitgemäße Sprache unter Einbeziehung des traditionellen kirchlichen Sprachgebrauchs. Es ist eine insgesamt sehr gut verständliche Übersetzung mit durchaus literarischem Anspruch.
###info-1###
Die Bedeutung der Neuen Genfer Übersetzung
Es ist das Anliegen der Neuen Genfer Übersetzung, bei der kommunikativen Wiedergabe des Textes gleichzeitig so philologisch wie möglich zu arbeiten. Die inhaltliche und sachliche Genauigkeit hat für sie zwar erklärtermaßen Vorrang vor der formalen Übereinstimmung mit dem Grundtext, aber durch ihren ausführlichen Anmerkungsteil und die Kennzeichnung der Zufügungen zum Text stellt sie immer auch wieder die Verbindung zur Form des Grundtextes her. Dadurch eignet sie sich besonders für Menschen, die gerne mit verschiedenen Bibelübersetzungen arbeiten und ohne Kenntnis der biblischen Originalsprachen nachvollziehen wollen, wie es jeweils zu den unterschiedlichen Übersetzungen kommt.