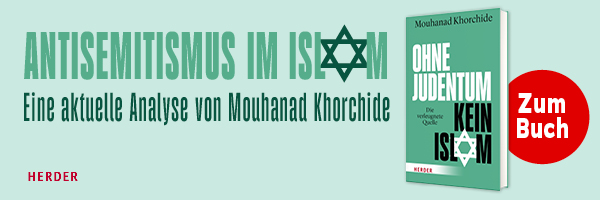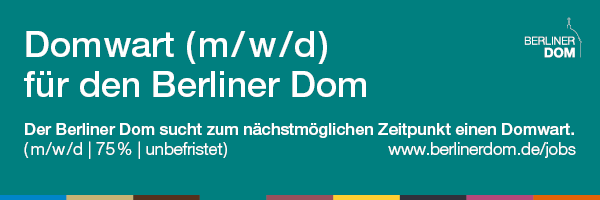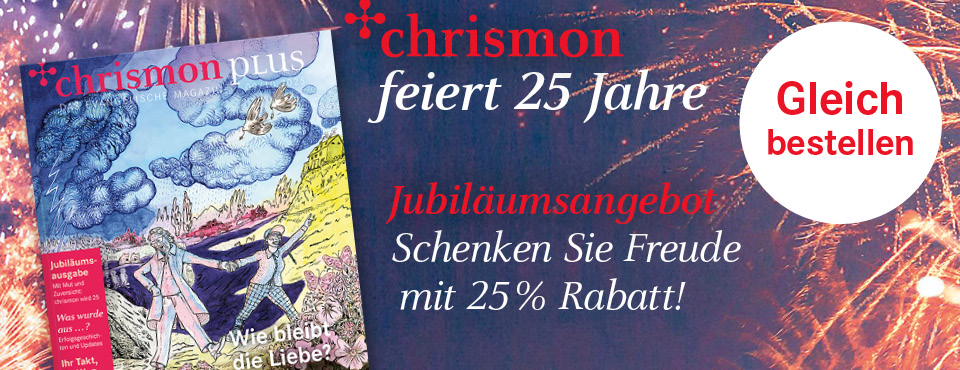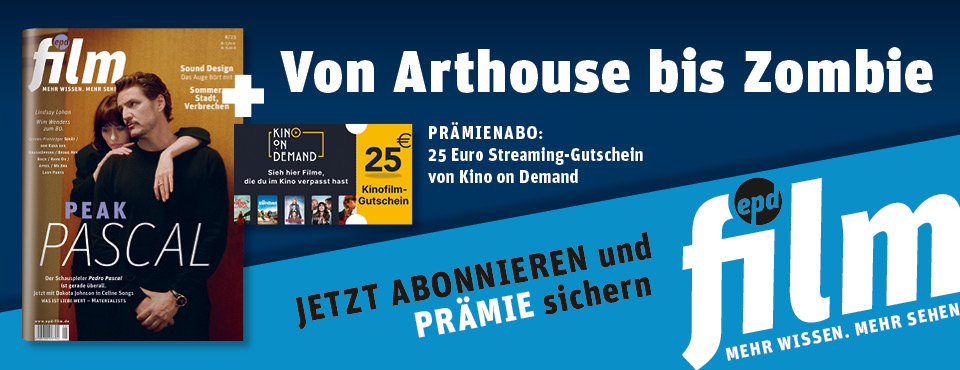Das Tempo, mit dem Künstliche Intelligenz (KI) Schule und Lernen verändert, haben viele unterschätzt. "Wahrscheinlich haben Schüler KI vor den Lehrern entdeckt", mutmaßt Andrea Herrmann gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd). Sie leitet beim Evangelischen Schulwerk Baden und Württemberg (Stuttgart) das Digitalisierungs-Projekt der Evangelischen Landeskirche Württemberg "Aufs Ganze gesehen".
Ziel ist es, in Workshops und Fachfortbildungen die landesweit rund 250 evangelischen Schulen zu vernetzen und Impulse für neue - digitale - Entwicklungen anzustoßen. Angesichts des rasanten technischen Fortschritts stelle sich die Frage, welche bisherigen Lernformate noch zeitgemäß seien, sagte Herrmann. Auch Prüfungsformate müssten auf den Prüfstand, ist die Pädagogin überzeugt.
Zwar fehlen bislang konkrete Zahlen, wie viele Schüler mit KI schummeln. Doch die Sorge über Fehlinformationen und den unethischen Einsatz von Technologie im Klassenzimmer in Deutschland wächst. Tatsächlich wünschen sich laut dem Bildungsreport 2025 von GoStudent, einem Nachhilfe-Anbieter, 62 Prozent der Schüler, dass ihre Lehrkräfte besser über KI informiert sind, um diese auf konstruktive und ethische Weise im Unterricht einsetzen zu können.
Flexibler als ein Lehrbuch
Künstliche Intelligenz verändere die Art und Weise, wie Schüler an ihre schulischen Aufgaben herangehen, bestätigt Gunnar Horn. Der Leiter der Beruflichen Schulen am Schloss Gaienhofen am Bodensee beobachtet gerade bei Oberstufenschülern einen versierten Umgang mit KI. "Da wird die KI zum Mentor, da ist plötzlich ein Gegenüber, das weiß, worum es geht", sagt Horn.
In Biologie etwa werde nicht der Zitronensäurezyklus abgefragt, sondern nachgefragt, wie genau die einzelnen Zyklusschritte ablaufen und somit, ob der Schüler den Lerninhalt verstanden habe. Chancen sieht Horn außerdem beim "individualisierten" Lernen, das heißt speziell auf den einzelnen Schüler abgestimmten Übungsaufgaben. Eine Mathe-KI könne etwa während der Übung analysieren, welche typischen Fehler der Schüler macht, und weise ihn auf diese Fehler hin.
Das sei "eine Fähigkeit, die bisher kein Lehrbuch hat", betont Horn. Ähnliches gelte für eine Rechtschreib-KI, mit der Schüler bei Diktaten gezielt an ihren Schwachpunkten arbeiten könnten. Hilfreich seien solche Tools auch bei den ersten Versuchen, sich mündlich in einer Fremdsprache auszudrücken.
Mehr Zeit für Gespräche
Mit Blick darauf, dass fast jeder zweite Grundschüler einen Migrationshintergrund habe, könne auch hier die KI als "Korrektor" eingesetzt werden. "Ich sehe hier eine große Hilfe für Schüler, die sich sprachlich nicht gut ausdrücken können, seien es Migranten oder Menschen aus dem Autismus-Spektrum", zeigt sich der Schulleiter überzeugt.
Profitieren können aus seiner Sicht auch die Lehrerinnen und Lehrer. Statt stundenlang individuelle Lernmaterialien zu erstellen, erledige die KI das "in zwei Minuten". Die Zeitersparnis wiederum komme Schülern zugute. "Wenn es gut läuft, können wir unsere diakonische Aufgabe besser erfüllen, nämlich Motivation, Beziehungen und Vermittlung von Werten", so Horns Hoffnung.
"Lehrkräfte bekommen durch KI mehr Zeit für Gespräche", stimmt Andrea Herrmann zu, warnt jedoch davor, dass im sonderpädagogischen Bereich viele Schüler gerade nicht konstruktiv mit KI umgehen könnten. Es komme beim Einsatz von KI auf das "richtige Maß" bei gleichzeitiger "Offenheit für die Lebenswelten der Schüler" an, sagte Herrmann. Gefahren durch KI räumt auch Horn ein, etwa wenn die KI das Ergebnis schlichtweg vorgibt.
"Das ist, als würde ich ein Foto von der Gipfeltour nur hoch oben auf dem Gipfel machen, nicht aber den Weg dahin abbilden", beschreibt er. Lehrkräfte müssten lernen, prozessorientiert abzufragen und digitale Ablenkungen auszuschalten, darin liege ihre Verantwortung, betont er und gibt sich zuversichtlich: "Diese Hilfsmittel nicht zu benutzen, wäre schade. Wir haben uns ja auch an den Taschenrechner gewöhnt", sagte Horn.