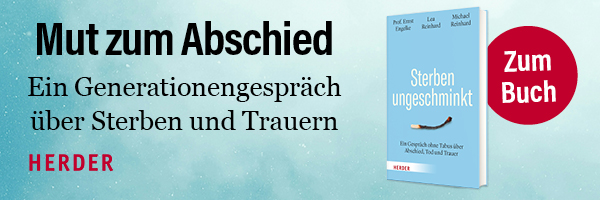Bergen-Belsen (epd). Im ehemaligen niedersächsischen Konzentrations- und Kriegsgefangenenlager Bergen-Belsen bei Celle ist am Sonntag eine neue Sonderausstellung eröffnet worden. Im Fokus der Ausstellung „Ein Tatort: Bergen-Belsen“ stehe die Frage nach den Motiven der Täter, teilte die Gedenkstätte am Sonntag mit. „Es braucht eine Auseinandersetzung mit den Tätern, um besser zu verstehen, wie es zu diesen Taten kommen konnte“, sagte Elke Gryglewski, Leiterin der KZ-Gedenkstätte am Sonntag bei der Ausstellungseröffnung.
Bis zum 15. Dezember sind in Bergen-Belsen auf Stellwänden und Monitoren Fotos, Briefe, Tagebuchaufzeichnungen, Prozessunterlagen und andere historische Dokumente zu sehen. Dabei werden einzelne Täter vorgestellt und gezeigt, wie staatliche Institutionen Leiden und Sterben der Lagerinsassen gezielt förderten und dass dieses Vorgehen von großen Teilen der Zivilbevölkerung gebilligt wurde. Zudem wird thematisiert, dass nur eine Minderheit der KZ-Wachmannschaften und ihrer Leitung sich nach dem Krieg vor Gericht verantworten mussten.
Die ungelernte Elisabeth Volkenrath etwa sah einen vierwöchigen Kurs zur KZ-Aufseherin als berufliche Chance. Sie nutzte ihre Stellung zur brutalen Machtausübung. Bevor sie im Konzentrationslager Bergen-Belsen eingesetzt wurde, entschied sie im ehemaligen KZ Auschwitz-Birkenau darüber, welche Häftlinge in die Gaskammer geschickt wurden. Hertha Ehlert galt dagegen bei den Gefangenen anfangs als vergleichsweise hilfsbereite KZ-Aufseherin, doch mit zunehmender Zeit wendete sie immer häufiger Gewalt an.
Herbert Papst war Wachmann im Kriegsgefangenenlager Bergen-Belsen. In einem Brief von 1941 schreibt er: „Es ist wirklich nicht schade um diese Untermenschen. Wir haben hier viele Beerdigungskommandos.“ Fritz Rau trat bereits 1932 der SS bei, machte im KZ-System Karriere und organisierte ab 1943 im KZ Bergen-Belsen als Arbeitsdienstführer die Zwangsarbeit. Von Häftlingen wird er als skrupelloser Leuteschinder bezeichnet, der kranke Gefangene schwere Arbeit verrichten ließ.
In den in der Ausstellung präsentierten Zitaten der Täter sowie in Aussagen ihrer Opfer zeigen sich Rassismus, Skrupellosigkeit und Gewaltbereitschaft ebenso als Antriebsfeder wie Gleichgültigkeit, Gruppendruck und die Aussicht auf materielle Vorteile und berufliche Karriere. „Es gibt große Unterschiede bei den Gründen, warum sich Menschen an den Verbrechen beteiligten“, sagte Gryglewski.
Am Ende der Ausstellung wird der Blick der Besucher auf die Gegenwart gelenkt und gefragt: Was hilft Menschen, nicht zu Tätern zu werden? Welche Regeln brauchen Institutionen, damit sie sich nicht an Verbrechen beteiligen? In Bergen-Belsen starben bis 1945 mehr als 70.000 Menschen an Misshandlungen, Krankheiten und Hunger - 52.000 KZ-Häftlinge und rund 20.000 Kriegsgefangene, unter ihnen das jüdische Mädchen Anne Frank, deren Tagebuch weltbekannt wurde.