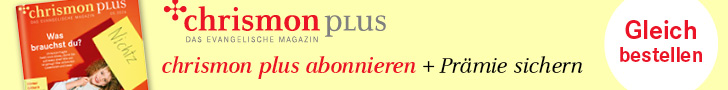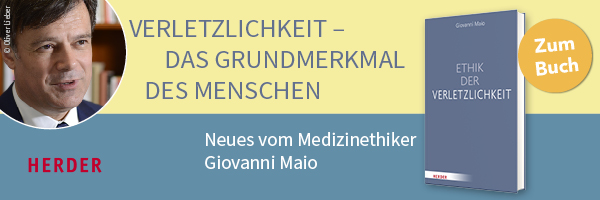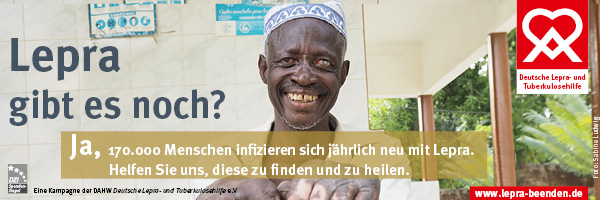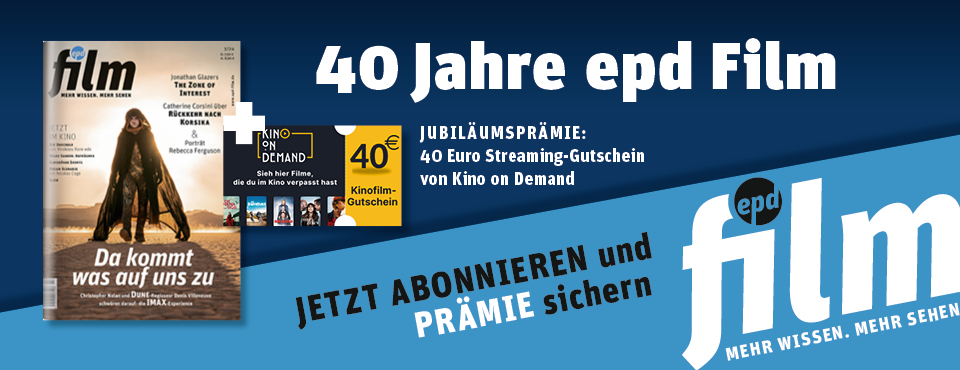Bonn (epd). Die katholische Deutsche Bischofskonferenz will die Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs in ihren 27 Bistümern einheitlich und verbindlich regeln. Die Aufarbeitung soll außerdem regelmäßig von unabhängiger Seite überprüft werden. Darauf haben sich die 27 Bischöfe mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, nach monatelangen Beratungen geeinigt. Die zentralen Kriterien der Aufarbeitung seien Unabhängigkeit, Transparenz und die Beteiligung von Betroffenen, heißt es in einer am Dienstag in Bonn veröffentlichten gemeinsamen Erklärung.
Rörig sagte, er sei "sehr froh und erleichtert" und sprach von einer "historischen Entscheidung". Transparenz, Einheitlichkeit und Betroffenensensibilität würden jetzt verbindlich. Er forderte die Bischöfe aber auf, zügig dafür zu sorgen, dass die Aufarbeitungskommissionen ihre Arbeit aufnehmen können. Der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz, Bischof Stephan Ackermann (Trier), erklärte, er erwarte sich von der gemeinsamen Erklärung einen weiteren Schub für die Aufdeckung und Bekämpfung sexualisierter Gewalt im Raum der Kirche.
Zu den Maßnahmen zählt die Einrichtung von Aufarbeitungskommissionen in den einzelnen Bistümern, die aus sieben Mitgliedern bestehen sollen. Unter den sieben Mitgliedern sollen zwei Betroffene sein. Zudem soll es auch Betroffenenbeiräte geben, die die Arbeit der Kommissionen begleiten. Ein Beirat könne aber auch mehrere Kommissionen begleiten, heißt es in dem Papier.
Die Beteiligung von Missbrauchsopfern war in den Beratungen eine Forderung des Missbrauchsbeauftragten gewesen. Die Betroffeneninitiative Eckiger Tisch kritisierte, dass es statt einer nationalen "Wahrheits- und Gerechtigkeitskommission" nun 27 Kommissionen geben werde. Das erschwere das Monitoring, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme.
Der Zugang zu kirchlichen Archiven für die Aufarbeitung war ebenfalls ein wesentlicher Punkt in den Beratungen. In dem Dokument ist nun festgehalten, dass sich die Bistümer zu einer Kooperation mit den Aufarbeitungskommissionen verpflichten und deren Mitgliedern auch Akteneinsicht gewährt wird, wenn dies für ihre Arbeit nötig ist. Gewahrt werden müsse aber das kirchliche Datenschutzgesetz. Die Kommissionen sollen jährlich über ihre Arbeit an den zuständigen Ortsbischof und an den Missbrauchsbeauftragten berichten.
Die Überprüfung des tatsächlichen Willens zur Aufarbeitung finde in der Wirklichkeit statt, erklärte der Eckige Tisch. Dabei gehe es darum, dass tatsächlich die Kommissionen eingesetzt, Betroffene beteiligt, der Zugang zu den Akten ermöglicht und die Ergebnisse veröffentlich würden.
Die Bischofskonferenz hatte im September 2018 nach der Veröffentlichung ihrer Missbrauchsstudie beschlossen, für die Aufarbeitung auch enger mit dem Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung zusammenzuarbeiten. Seit Mai 2019 wurde über die gemeinsame Erklärung beraten. Der Ständige Rat der Bischofskonferenz, in dem die 27 Ortsbischöfe vertreten sind, hatte der Erklärung in seiner Sitzung am Montag zugestimmt, heißt es in der Mitteilung.
Auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) arbeite eng mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung zusammen, teilte ein Sprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. In dem elf Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog der EKD ist der Austausch mit dem Missbrauchsbeauftragten schon vorgesehen. Eine ähnliche Erklärung wie die der Bischofskonferenz sei derzeit nicht in Arbeit.